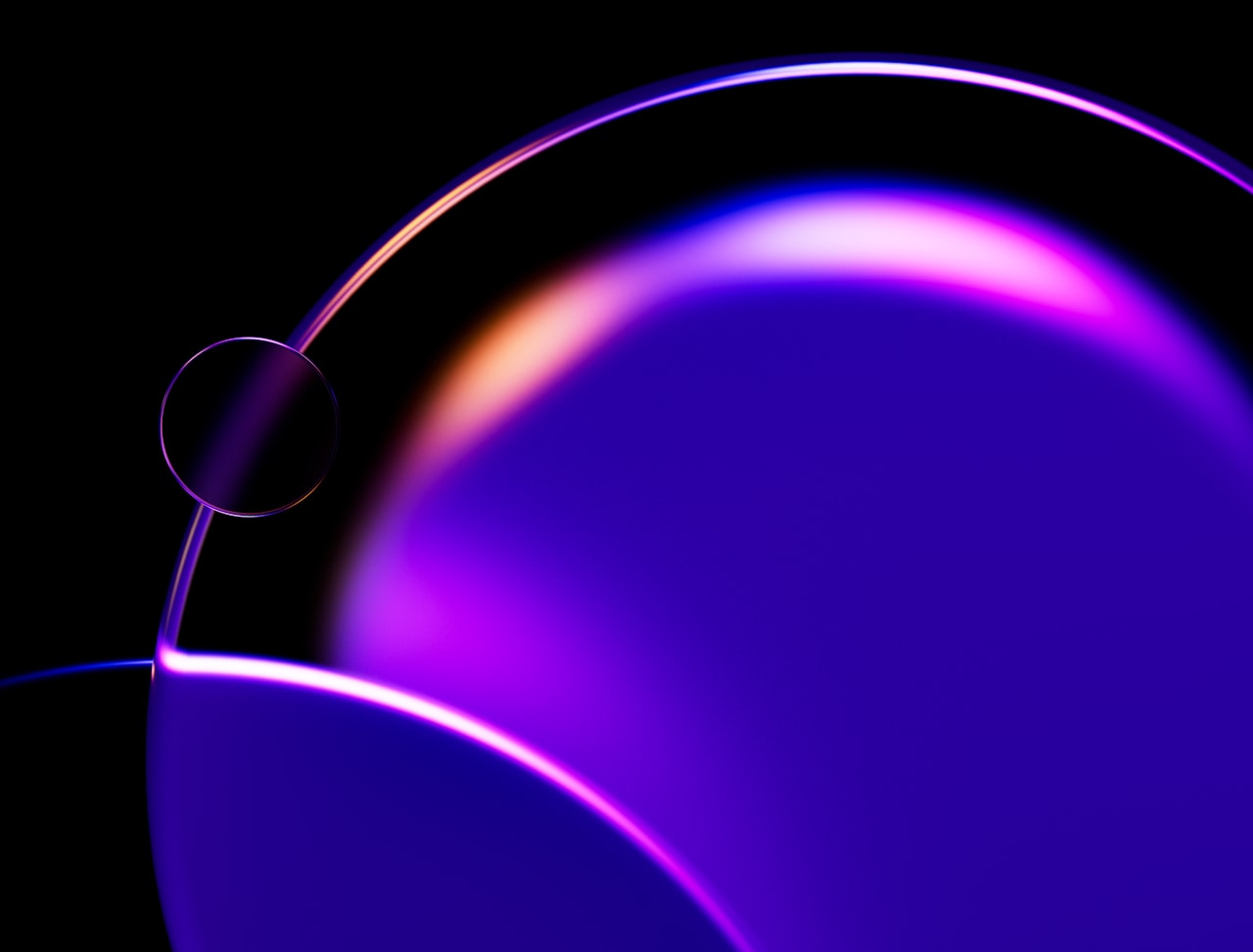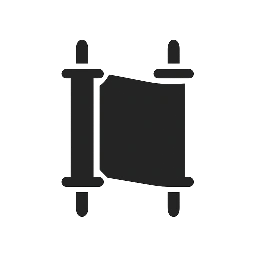Das Argula-von-Grumbach-Denkmal in Lenting, zwischen Rathaus und Schule; es ist von Stefan Weyergraf-Streit entworfen worden.
Bildnachweis: Erik Händeler
Der Kirchenkrimi Lenting und die Reformen von morgen
Was das Verschwinden einer historischen Urkunde über Menschen erzählt, über die (bisherige) Kirche von Eichstätt, und über den Staat.
Von Erik Händeler
Würden Sie weghören? Wenn Ihnen jemand erzählt, dass etwas gestohlen wurde, in ihrem Umfeld. In der Arbeit, im Verein, oder ja, in der Kirche. Sie könnten sich wegdrehen, weil es Sie ja nicht persönlich betrifft. Sie könnten Besseres zu tun haben. Sie könnten sich auch abwenden, weil es Ärger bedeutet, sich einzumischen.
Aber wenn Sie sich entscheiden, der Sache nicht nachzugehen, dann müssten Sie auch davon ausgehen, dass es in Zukunft in Ihrem Umfeld nicht ehrlich zugeht, wenn Sie nicht selber dafür sorgen.
Der Verdacht, der bisher nicht ausgeräumt wird: Dass der eine Pfarrer klaut, der Mesner hilft; der Ortspfarrer vertuscht es, der Eichstätter Bischof Hanke klärt nicht auf; und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt untersucht weder Spuren noch hört sie jene Zeugen, die sich gut daran erinnern, dass eine historische Urkunde aus dem Jahr 1500 im Turmzimmer der Lentinger Kirche hing. Um was es sich genau handelt, ist eigentlich egal; es könnte ein silberner Kerzenständer sein oder 100 Euro aus dem Klingelbeutel.
In dieser Geschichte geht es für den Bürger darum, ob der Staat bei der Kirche nicht ausreichend genau hinsieht. Säkularen, die der Kirche aus sozialen und ethischen Gründen eigentlich positiv gegenüberstehen, stellt sich die Frage, wie mit einer Kirche umzugehen ist, wenn sie sich nicht an ihre eigenen verlautbarten Standards hält. Bei ihren jüngeren Skandalen ging es nur vordergründig um sexuellen Missbrauch; das eigentliche Thema ist das Vertuschen, also Gesichtswahrung wichtiger zu halten als Wahrheitssuche, oder gar den Opferschutz. Leute, die unserem historischen Erbe einen Wert beimessen, könnten verlangen, dass geschichtliche Zeugnisse nicht zerstört werden dürfen, selbst wenn formaljuristisch die Kirche die Besitzerin ist. Für die allermeisten Leser geht es hier um gar nichts, weil für sie Kirche irrelevant geworden ist und gesellschaftlich nur noch ein Verein unter vielen.
Aber nehmen wir mal die Perspektive von Leuten ein, die an Gott glauben, denen die davon abgeleiteten Werte wie Wahrhaftigkeit, Allgemeinwohl, gegenseitiges Kümmern wichtig sind, und sich daher auch eine funktionierende Institution dazu wünschen. Solchen Leuten schmerzt es am meisten, wenn die Glaubwürdigkeit der Kirche leidet, wenn Aussagen und Tun nicht übereinstimmen, etwa wenn – wie hier – mögliche Straftaten nicht so aufgeklärt werden, dass sie auch zu einem nachvollziehbaren Ergebnis führen.
Das ist nur ein Symptom für größere Missstände in der Kirche: Wenn es dort kein innerkirchliches Miteinander gibt, wenn ein Bischof – wie der Eichstätter Bischof Hanke – Gremien auflöst (Pastoralrat), entmachtet (Domkapitel) oder ignoriert (Diözesanrat), damit dann drei Männer im Hinterzimmer (mit Amtschef und Generalvikar) undurchdachte Entscheidungen treffen, denen der Rest ohnmächtig zuschauen muss.
Schlechte Kommunikation, das daraus entstehende Missmanagement, der schlechte Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine Kultur, in der Macht und Beziehung mehr gelten als Inhalt: Der Zig-Millionen-Euro-Schaden der Diözese Eichstätt, verursacht durch spekulative Geldanlage in den USA, halte ich für die Folge von mangelnder Transparenz und fehlendem Mehr-Augen-Prinzip. Was eine Weltsynode beschloss und Papst Franziskus unterschrieb, was die Deutsche Bischofskonferenz an „gemeinsam Kirche sein“ textete, ist lediglich Papier, wenn es dann keine Auswirkungen hat auf das, was in einer Diözese wie Eichstätt passiert; etwa wenn ein Zeuge auf einen möglichen Diebstahl hinweist, und dann alle Energie der Verantwortlichen darin fließt, eine echte Aufklärung zu verhindern.
Die Geschichte von der verschwundenen Ablassurkunde des Jahres 1500 in Lenting ist also vor allem eine Geschichte darüber, welche Reformen die Kirche heute braucht – gerade mit Blick auf die Neubesetzung des Bischofsstuhls in Eichstätt. Dabei könnte Kirche in einer Welt, in der Regeln zurückgedrängt werden für das Recht des Stärkeren, helfen, dass in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nach Regeln gespielt wird – dafür müsste sie aber erst selber wieder ihre Glaubwürdigkeit zurückerlangen. Und in dem aktuellen Strukturwandel, in dem Maschinen die materielle Arbeit leisten, und Computer/KI dann auch strukturierte Wissensarbeit übernehmen, in diesem Strukturwandel könnte Kirche Orientierung geben, wie die Menschen hinter der Technik für ein großes Ganzes zusammenwirken (nicht hierarchisch, sondern inhaltsorientiert vernetzt). Das hier ist also vor allem auch eine Geschichte über die Chancen, die Kirche für die Gesellschaft bieten könnte.
Geklaut und vertuscht?
Dass das Dorf Lenting im ausgehenden Mittelalter ihre kleine Kirche ausbauen konnte samt spätgotischem Flügelalter, verdankt es dem (Aber)Glauben, ein Mensch könnte sich das Himmelreich und die Tilgung seiner Sünden mit Geld erkaufen. Der damalige Pfarrer Wolfgang Crener hatte eine Zeit lang im Vatikan gearbeitet; seine Kontakte waren gut genug, dass zwölf Kurienkardinäle im Heiligen Jahr 1500 einen Ablassbrief unterschrieben, der den Gläubigen jeweils so 30 bis 40 Tage Fegefeuer erlassen konnten, also insgesamt mehr als ein Jahr, wenn sie – so steht das in der Urkunde – ihr Geld gaben für den Bau der Kirche, für Altarerrichtung und Kirchengerät. Das war also kein Massendruck, sondern eine individuelle Ausfertigung, handschriftlich, sogar auf dem damals seltenen Papier statt Pergament, unterschrieben am 20. April 1500.
Diesen Ablassbrief muss die damalige Ortsadelige Argula von Grumbach vor Augen gehabt haben, als sie Martin Luther unterstützte. Der stritt seit 1517 öffentlich gegen das Sündengeschäft, während die gelehrten Professoren an der nahen Universität Ingolstadt es verteidigten. Dass die streitbare Ortsadelige aus Lenting sie attackierte, war für eine Frau damals ein Wagnis – ihr Mann, der Landvogt Friedrich von Grumbach, musste deshalb seinen Posten räumen.
Das historische Dokument hat in der Kirche die Reformation überlebt; sie hat überlebt, als im 30jährigen Krieg die Schweden kamen und von den 300 Einwohnern 100 starben. Sie hat die Säkularisierung überlebt und all die anderen Umbrüche und Notzeiten. Theologisch war sie zwar schnell überholt. Aber als „Finanzierungs-Urkunde“ des frühneuzeitlichen Ausbaus samt Altar wurde sie in Ehren gehalten und von Zeit zu Zeit dem Kirchenvolk im Gottesdienst gezeigt und erklärt. Aufbewahrt wurde sie im Zimmer neben dem Altarraum, von dem es hoch zum Turm geht. Bis zur Vergrößerung der Kirche 1927 diente der Raum als Sakristei, danach wurde er kaum noch betreten. Und dort hing der Ablassbrief als weißes Papier wenig auffällig, rechts unter dem Fenster, zuletzt in einem dicken Eichenrahmen hinter Glas, schwer an die Wand geschraubt. Aufgelistet ist sie auch in früheren Inventarverzeichnissen, das Jüngste ist von 1938.
Ich erinnere mich an die Grundschule, in der die Messdiener ehrfürchtig von der alten Urkunde im Turmzimmer sprachen. Einige ehemalige Oberministranten erinnern sich auch heute daran, weil daneben das Weihrauchfass hing und sie dort den Weihrauch entzündeten. Von daher kennt auch Stefan Weyergraf-Streit (SWS) den Ablassbrief von Kindheits- und Jugendtagen in den 80er Jahren bis weit in die 90er Jahre hinein. Als Künstler hat er Kirchen ausgestattet, auch säkulare Kunst geschaffen, und ist dafür weit über die Region hinaus bekannt. Er lebt in Eichstätt, hat aber die Erforschung der Geschichte seines Heimatortes zu seiner Aufgabe gemacht.
Und mit der Ortsgeschichte kennt er sich aus: Akribisch hat er die Zugehörigkeit der Bauernhöfe zu verschiedenen Grundherren seit 1238 ausgearbeitet; er hat die Spuren der Römer und Kelten gesammelt und zu einer Geschichte verwoben, und die der Merowinger-Zeit; das Wasserschloss der früheren Grundherren hat er erforscht, oder Seitenthemen wie über den Lentinger, der nach dem 30jährigen Krieg als Abt das Kloster Plankstetten wieder aufbaute. Das Denkmal für die Argula von Grumbach vor der Schule in Lenting hat er konzipiert, ebenso die Weidenkirche am Materinbach. Er ist also nicht irgendwer, auch wenn das Pfarrei-Blatt ihn abfällig als „ehemaligen Lentinger“ diffamierte, um seine Aussagen herabzuwürdigen. Nun wollte er sich der Entwicklungsgeschichte der Dorfkirche zuwenden sowie der noch vorhandenen spätgotischen Madonnenfigur, die seinerzeit von dem Ablassbrief finanziert wurde. Aus diesem Grund besuchte er extra ein Historiker-Symposium in Velburg, das sich mit historischen Ablassbriefen beschäftigte. Die Aussage des Ortspfarrers Josef Heigl, der Stefan hätte halt irgendwo in einer anderen Kirche einen Ablassbrief gesehen und würde sich was einbilden, halte ich daher für völlig abwegig.
Zumal aus dem E-Mail-Verkehr laut Stefan Weyergraf-Streit hervorgeht, dass der Pfarrer genau wusste, um welche Urkunde es sich handelt und wo sie hängt, als er anfragte, ihm das Turmzimmer zu öffnen, um die Urkunde fotografisch zu dokumentieren. Seine Schwester und Mesnerin sperrte ihm dann die Kirche und das Turmzimmer am 6. April 2021 auf, sagt SWS. Weil die Sonne durch das Ostfenster schien, und bei Gegenlicht kein Foto möglich ist, wollte er die Urkunde abschrauben. Laut SWS gestattete ihm die Haushälterin, die Urkunde mit einem Schraubenzieher aus der Anrichte den Rahmen abzuschrauben, um sie so hinstellen, dass er sie ohne Spiegelung fotografieren könnte. Doch die Schrauben, in dicken Wandholzdübeln befestigt, waren eingerostet und ließen sich nicht mehr drehen. So verschob er das Foto auf einen späteren Termin, machte aber noch die Schwester des Pfarrers auf die Bedeutung der Urkunde aufmerksam.
Als er im September 2022 wieder kam, war die Ablassurkunde weg, die Stelle an der Wand war frisch weiß getüncht, berichtet er. Er informierte den Pfarrer, der in der Zeit ein paar Monate wegen Herzproblemen ausgefallen und von einem Nachbarpfarrer vertreten worden war; gemeinsam mit der Schwester suchte SWS im Pfarrhaus nach der Urkunde. Heigl versprach, sich darum zu kümmern. Und dann hörte Stefan Weyergraf nichts mehr, der Pfarrer rief nicht zurück. Als er nach zwei Monaten nachfragte, reagierte der Pfarrer unwirsch, da sei nie was gewesen. Und er habe für sowas keine Zeit. Er ging Gesprächen aus dem Weg, fand keinen Termin zur Klärung. So verhält sich m.E. jemand, der etwas zu verbergen hat. Denn wenn da wirklich nichts gewesen wäre, dann würde man sich geduldig anhören, was da jemand zu sagen hat. Das Angebot von Stefan Weyergraf-Streit (SWS) an den Pfarrgemeinderat, ihm den Fall darzustellen, nahm der nicht an.
Verdrängen oder Aufklären?
Im Nachhinein gesehen, sagt SWS heute, hätte er da schon die Polizei einschalten sollen. Aber aus Rücksicht auf seine Eltern und auf seine Heimatforschung wollte er den Verbleib der Urkunde gütlich klären. So erzählte er davon in vier-Augen-Gesprächen, auch mir. Das ist die Eingangsfrage zu Beginn dieses Textes: Weghören oder sich kümmern? Ich sprach daraufhin den Organisator des Geschichtskreise darauf an, der als früher entscheidender Gemeinderat eine gewichtige Stimme mitzureden hat am alten Dorf. Der ließ mich auflaufen; und als ich mich nicht abweisen ließ, wurde er unfreundlich. Also wusste ich für mich in diesem Moment, dass da nicht nichts sein kann. Ich fing an, Fragen zu stellen. Auch der Mesner kam aggressiv auf SWS zu, und reagierte ebenso auf mich. Da erinnerte sich SWS daran, wie der Nachbarpfarrer zu ihm sinngemäß sagte, die Lentinger seien ja so doof, die glaubten noch an Ablass, und erwähnte einen getreuen Helfer. Weghören oder kümmern?
Insgesamt neun Monate dauerte es nach der Verlustmeldung, bis es auf mein Drängen hin im Juli 2023 zu einem Treffen in der Kirche kam. Ich hatte der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Angela Vogl die Dringlichkeit verdeutlicht und auch gestreut, dass ich Anzeige erstatten würde; in einer Mail bat ich sie, die weiße Stelle an der aschgrauen Wand zu fotografieren, an der die Urkunde hing, damit sie nicht übermalt werden würde; stattdessen leitetet sie meine Mail an den Mesner weiter, der ja nach Angaben von SWS dem Täter möglicherweise beim Abmontieren geholfen hat. Wenn das stimme, hatte Angela Vogl zu Stefan Weyergraf-Streit gesagt, dann könne sich der am Dorf ja nicht mehr blicken lassen. „Und wenn es halt doch so war?“, antwortete SWS.
Weil ich mit einer Manipulation der Wand rechnete, hatte ich SWS geraten, zuerst seine Erlebnisse zu erzählen, bevor wir in das Turmzimmer gingen. Zweimal wäre er vom Kirchenstiftungsvorsitzenden Karl-Heinz Amler beinahe vom Ambo verdrängt worden; Pfarrer Josef Heigl brüllte, was SWS sage, stimme alles nicht – so reagiert m.E. jemand, der in die Enge getrieben ist; seine Schwester schüttelte nur den Kopf. Aber wenn SWS wirklich alles erfinden würde, dann wäre der Pfarrer ja nur cool dagesessen. Später beweisen Fotos mit Orts- und Zeitangabe, dass SWS an dem angegebenen 6. April 2021 in der Kirche war, die er dort von der Monstranz gemacht hat. Darauf ist auch seine Frau zu sehen, die den Hergang mit Ablassurkunde im Turmzimmer und mit der Schwester des Pfarrers bezeugt. Daraufhin behauptet diese nun, sie habe zwar die Kirche, aber nicht das Turmzimmer aufgesperrt. Das ist wohl schon deshalb unwahr, weil der vorherige E-Mail-Verkehr belegt, dass SWS in das Turmzimmer wollte – warum hätte er sich nur die Kirche, nicht aber den Raum zum Ablassbrief aufsperren sollen, um den seine Forschung kreist? Hätte die Ingolstädter Staatsanwaltschaft von Anfang an Aussagen aufgenommen, würden Aussagen wie die der Pfarrersschwester je nach neuen Erkenntnissen auch nicht angepasst werden können.
Als wir dann die Stelle im Turmzimmer besichtigten, an der laut vieler, bislang ungehörter Zeugen die Urkunde hing, sah die Wand genauso schwarzgrau aus wie die Umgebung (was sich mit Schwamm, Rus und Asche leicht machen ließe), mit dem Unterschied, dass genau an der fraglichen Stelle ein fettes Spinnennetz hing, auf die mich einer der Mesner extra hinwies. Da sonst keine Spinnenweben zu sehen waren, scheint mir das extra hindrapiert worden zu sein. Immerhin sagte auch der Kirchenstiftungs-Vorsitzende Karlheinz Amler, er erinnere sich daran, dass an dieser Stelle irgendetwas gehangen habe, er wisse nur nicht, was; wenn seine Aussage stimmt, wäre klar, dass eine auf alt gemachte Wand, die so tut, als wäre da nie was gewesen, eine Lüge ist.
Wonach das für mich aussieht: Der Aushilfspfarrer könnte die Urkunde zusammen mit dem Mesner entwendet haben, der Pfarrer es vertuschen; und dann versuchen sie auch noch, den Diebstahl zu kaschieren, indem sie die Wand auf alt machen. Ob das so war oder ob SWS das alles nur geträumt hat: Um das zu klären, müsste die Polizei die Spuren in der Wand untersuchen, also die übermalte weiße Farbe, die verfüllten Bohrlöcher, in denen früher die alten Holzdübel steckten. Ich scheine der einzige zu sein, der die Wand untersuchen lassen will, um herauszufinden, welche Version stimmt; alle anderen wollen das nicht. Und das wird jetzt hier die eigentliche Geschichte, um deutlich zu machen, welcher grundlegender Reformstau in der Kirche besteht – und im Umgang mit Kirche.
„…konnte kein Täter ermittelt werden…“ – weil die StA gar nicht ermittelte
Ich war zunächst froh, dass nicht ich die Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei stellen musste, sondern dass der Kirchenstiftungsvorsitzende Karl-Heinz Amler mir das abnahm. Was ich nicht wusste, war, dass er eine Erklärung mitlieferte, von etwa fünf ehemaligen Mesnern unterschrieben: Dort an der Wand sei nie was gewesen. Wer die Anzeige so stellt, der will sie gar nicht ernsthaft aufklären, sondern ausbremsen. Dabei hat so eine Erklärung von wenigen Leuten keinerlei Beweiskraft – es könnten sich Mithelfer und Mitwisser darunter befinden, die sich selbst schützen; es könnten Gefälligkeitsaussagen für den Pfarrer sein oder auch welche aus Unkenntnis, wenn diese seit Jahrzehnten nicht mehr in das Turmzimmer gekommen waren. Für die Staatsanwaltschaft war das jedoch schon ausreichend, um weder Stefan Weyergraf-Streit als Zeugen zu vernehmen oder eine Spurensuche vorzunehmen – im Oktober 2023 schrieb die Staatsanwältin, ein Täter hätte nicht ermittelt werden können, ohne dass sie auch nur irgendetwas ernsthaftes unternommen hätte. Der Ortspfarrer Josef Heigl fühlte sich am Ziel und verkündete, das habe sich erledigt, die Staatsanwaltschaft habe den Fall eingestellt.
Nun schrieb ich ihm, sicher sei, dass es diese Urkunde gab, dass sie nun weg ist, und dass keiner erklären könne, wohin. Ob denn der Bischof davon wüsste? Deswegen meldete ich mich dort mit dem Material, Hankes Sekretär verwies mich auf den Diözesanarchivar Ferdinand Sturm. Der wiederum versuchte alles, um mir weitere Recherchen auszureden. Der Pfarrer Heigl sei doch Herzkrank, ob ich dann Schuld sein wolle, wenn der deswegen stirbt? Solche Urkunden gäbe es doch viele (nein, es ist ein absolutes Unikat), sei nicht viel wert (sie hat neben dem historischen auch einen hohen, fünf- bis sechsstelligen materiellen Wert); es sei normal, wenn da mal eine verschwinde (nein, ist es nicht). Damals seien Ablassbriefe aus Pergament gewesen und nicht aus Papier, wie Stefan Weyergraf-Streit für das Exemplar in Lenting angibt, sagt der Diözesanarchivar; daher sei der nicht glaubwürdig. Dabei ist es genau umgekehrt: Wenn SWS die Urkunde erfinden würde, dann würde er sie genau so beschrieben, wie sie sonst mehrheitlich alle sind; das damals ungewöhnliche Schreibmaterial zeigt, wie besonders und wertvoll die Urkunde ist.
Für mich unglaubwürdig auch weitere Einlassungen des Diözesanarchivars: Dass der Ablassbrief in einer Inventarliste von 1938 auftauche, hieße ja nicht, dass es den damals noch tatsächlich gegeben habe – das ist so, wie wenn er einem Supermarktbesitzer nach einem Ladendiebstahl sagt, seine Inventarlisten stimmten halt nicht. Und was er als Vermutung vorträgt, ist ja nur eine Vermutung, und nichts, was verwertbar wäre. Auf einem Foto, dass der Archivar von der Wand in der Kirche gemacht hat, ist übrigens kein Spinnennetz zu sehen, das dann eine Woche später bei dem Treffen mit den Beteiligten an der Wand hing – was für eine Posse. So ein Diözesanarchivar wird vom Kirchensteuerzahler dafür bezahlt, das historische Gedächtnis zu sichern, und nicht, einem Journalisten das Fragestellen auszureden, damit niemand herausfindet, was aus der Urkunde wurde. Ich habe ein paar Mails an Bischof Hanke geschrieben, etwa dass er intern deutlich machen sollte, dass Kirchenmitarbeiter nicht ihre Kollegen vor den Folgen ihres Tuns schützen, sondern die Wahrheit suchen sollten, aber ich bekam keine Antwort.
Gibt es eine unausgesprochene Erwartung, Kollegen zu schützen?
In einer funktionierenden Kirche würde ein Bischof alle Beteiligten an einen Tisch holen bzw. holen lassen. Er würde jemanden in die Gemeinde schicken, der vermittelt. Er würde so etwas wie eine Wahrheitskommission einsetzen, die die Fakten festhält. Er würde die Öffentlichkeit um Hinweise bitten, wer die Urkunde kennt und vielleicht etwas über den Verbleib weiß. Ich halte es für nahe liegend, dass Bischof Hanke genau das vermeiden wollte. Denn dann würden sich ja einige melden, und das „da war nie was“ ließe sich nicht mehr aufrechterhalten. In einer Situation, in der die Katholische Kirche in Deutschland ihre Glaubwürdigkeit verloren hat, weil sie teils systematisch Täter geschützt und Opfer gedemütigt hat, sollte ein Bischof mit seinem demonstrativen Handeln jedem Verdacht entgegentreten, dass hier wieder eine mögliche Straftat eines Pfarrers vertuscht werden sollte.
Warum hat sich der Lentinger Pfarrer Heigl eigentlich nicht einfach zurückgelehnt, als Stefan Weyergraf-Streit ihm den Verlust der Urkunde meldete? Er hätte es ja bequem nach Eichstätt abgeben können. Vielleicht, weil er wusste, dass „Eichstätt“ alles tun würde, um Mitarbeiter zu schützen? Weil Heigl wusste, dass im Eichstätter Hanke-System unausgesprochen von einem erwartet wird, dass er seinen Kollegen vor den Folgen seiner möglichen Tat schützt? Was wäre passiert, wenn er den Verlust innerkirchlich angezeigt hätte – hätte „Eichstätt“ ihn auflaufen lassen wie mich, hätte er Nachteile befürchten müssen? So wie Josef Heigl gehandelt hat, wäre das dann genau so, wie es unausgesprochen von ihm erwartet würde. Also das – wie bei manchen Missbrauchsskandalen zu Tage getretene – kirchliche Verhaltenspotential durchzuprobieren wie verzögern, leugnen, Nebelkerzen werfen, abwimmeln, drohen, verschleppen.
Und warum hilft der Diözesanarchivar nicht, anstatt sich Begründungen auszudenken, warum der Fall nicht weiter untersucht werden sollte? Er hätte ja zur Aufklärung beitragen können. Denn bei einer Urkunde dieser Bedeutung, von zwölf Kurienkardinälen individuell ausgestellt, gibt es wahrscheinlich eine Kopie im Vatikanarchiv. Warum hat er da nicht nachgefragt? Ich vermute: Weil das die Angaben von Stefan Weyergraf-Streit bestätigen könnte. Auf jeden Fall übersteigt er seine Kompetenz, wenn er nach Augenschein behauptet, an der Wand könne keine Urkunde gehangen haben – er ist ja nicht von der Spurensicherung. Genauso wenig Gewicht haben Aussagen, die Inventurlisten seien nicht zuverlässig – ich halte das für Interessen geleitet, um eine Untersuchung zu verhindern. Warum? Weil es von ihm erwartet wird? Per Anweisung? Oder Unausgesprochen? Die Schere im Kopf? Dass es Bischof Gregor Maria Hanke selbst ist, der eine Aufklärung torpediert, darauf deuten weitere Vorgänge hin, siehe weiter unten.
Ich habe alles, wirklich alles probiert, um diesen Fall aufzuklären, auch um auszutesten, wie diese Institution Kirche von Eichstätt heute funktioniert, um den Änderungsbedarf festzustellen. Im Januar 2024 hatte ich einen Termin bei Amtschef Thomas Schäfers. Es ging um meine Fragen nach den Gremien wie dem Pastoralrat, den Bischof Hanke seit 2015 ohne Angaben von Gründen nicht mehr einberufen hatte, und um den Ablassbrief. Ich versuchte, den Amtschef davon zu überzeugen, dass die Diözese Eichstätt den Fall untersuchen sollte. Ich berichtete ihm von meinen persönlichen Erlebnissen am Ort, und warum ich glaube, dass Stefan Weyergraf-Streit die Wahrheit sagt. Er hörte mir mit versteinertem Gesicht zu, brachte pro forma ein paar Einwände des Diözesanarchivars, die ich ja längst schriftlich widerlegt hatte. Zum Abschluss sagte Amtschef Schäfers, bei ihm zu Hause in Paderborn, in seiner Diözese, würde so ein Fall aufgeklärt werden. Das ist demnach gar nicht seine Entscheidung, sondern allein die Verantwortung von Gregor Maria Hanke.
Ich habe die vom Gesetzgeber geforderte und neu eingerichtet Whistleblower-Hotline ausgetestet, und festgestellt: Auch das ist keine neutrale Institution, die einen Bischof zu irgendetwas bewegen kann. Zwar landet man in einer Anwaltskanzlei. Und eine Mitarbeiterin nimmt dann auch die Aussagen von Stefan Weyergraf-Streit zu Protokoll. Aber es passiert nichts. Der Fall landet wieder auf dem Schreibtisch des Amtschefs, der ja von Hanke längst so entschieden ist, ihn nicht aufzuklären.
Dass das so ist, zeigte sich, als ich versuchte, den Fall vor den Diözesanrat zu bringen – ein Test mehr, der scheiterte. Ich hatte für die Vollversammlung im September 2024 einen Antrag gestellt, dass Hinweisgeber in Zukunft gehört werden sollten. Ich beschrieb den Fall, wie Stefan Weyergraf-Streit ignoriert, nicht gehört, abgekanzelt wurde. Mein Ziel damit war, dass es etwas wie nachvollziehbare Regeln in der Kirche geben sollte, wie in so einem Fall zu verfahren ist. Bischof Hanke berief den Vorstand des Diözesanrates ein und verlangte, dass mein Antrag zurückgezogen werden müsste. Als Begründung gab er laut mehrerer Anwesenden an, er müsse „seine Mitarbeiter schützen“. Wo genau steht das denn, dass er das „müsse“? Im Kirchenrecht? In der Bibel? Nein, das ist allein seine Entscheidung, ob er das bisherige System persönlicher Loyalitäten fortführt oder umkehrt zum Evangelium.
Ein Bischof sollte nach dem Prinzip Nächstenliebe handeln, die berechtigten Interessen von Stefan Weyergraf-Streit als gleichwertig erachten und daher für Klärung sorgen. Wenn Hanke sagt, er müsse seine Mitarbeiter schützen (und nicht etwa den Zeugen vor Angriffen und Herabsetzungen), dann halte ich genau das für die Definition von kirchlicher Vertuschung. Hanke repräsentiert m.E. das Kernproblem der Katholischen Kirche in Deutschland. Wenn Hanke wirklich seine Mitarbeiter beschützen wollte, dann würde er sie befreien von der unausgesprochenen Last, eine mögliche Straftat ihres Kollegen zudecken zu müssen (darum habe ich den Bischof sinngemäß in einer Mail gebeten, aber wie immer keine Antwort erhalten). Dabei glaube ich nicht, dass es Hanke überhaupt um Mitarbeiter geht, für die er sich – das entnehme ich zahlreichen Rückmeldungen – sowieso nicht zu interessieren schien. Es geht m.E. um Macht. Um die Macht, nicht hinterfragt zu werden, und Fragesteller so abzuwürgen, dass sich auch kein anderer mehr traut, Fragen zu stellen. Es geht um die Macht, sich nicht an Regeln halten und sich nicht nach Fakten richten zu müssen, sondern auch weiterhin nach persönlicher Willkür zu entscheiden. Es geht um die Macht, etwas öffentlich zu sagen, was zurechtgebogen, unwahr, ja eine glatte Lüge ist, und es niemanden gibt, der das richtigstellt. Damit ein Pfarrer sagen kann, „da war nie was“, und das dann vor Ort als unhinterfragbare Tatsache gilt. Das ist Grund, warum es jetzt Reformen und kontrollierende Instanzen in der Kirche braucht.
Die Causa Ablassbrief erklärt das Verhalten von Bischof Hanke beim Synodalen Weg
Wo ist der bisherige Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke die vergangenen 15 Jahre gewesen? Und viele andere mit ihm: Ich bin etlichen Leuten begegnet, die sagen, Hanke ist ein guter Bischof, denn der ist schließlich gegen den Synodalen Weg.
Wir alle kennen den Fall eines Priesters aus Eichstätt, der in der Vergangenheit Frauen missbrauchte, per Haftbefehl gesucht wurde, vom damaligen Bischof Brems zuerst in Afrika und dann in Südafrika versteckt wurde, wo er seine Untaten weitertrieb, bei vollen Bezügen aus Eichstätt, um dann im Alter hier so weiter zu machen wie zuvor. Auch wenn es in anderen Teilen der Gesellschaft sexuellen Missbrauch gibt: Der eigentliche Skandal in der Kirche war das Wegschauen der Verantwortlichen, eine systemische, flächendeckende Tatsache. Eine Kultur, in der es immer darum geht, das Ansehen zu wahren, sich gegenseitig zu schützen, keine Schuld anzuerkennen, und nicht zu versuchen, sie wieder gut zu machen. Nur um die eigene Macht aufrechtzuerhalten, unwidersprochen nach eigenem Gutdünken agieren zu können – das ist weitestmöglich entfernt vom Evangelium, das wir in die Welt tragen wollen. Und der Lentinger Vorgang zeigt, dass es eben nicht um Sex geht, sondern um ein systemisches Problem einer autokratischen Organisation, in der es manchmal keine Regeln gibt, und die, die es gibt, nicht immer kontrolliert werden, und am Ende zählt, wer wen kennt.
Die Kirche insgesamt hat erst unter äußerem Druck darauf reagiert, nachdem seit 2010 immer mehr Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit ans Tageslicht gekommen sind. Aber viele Beispiele zeigen, dass Aufklärer resigniert aufgeben, weil sie immer noch auf Widerstand stoßen und behindert werden. Um das Verhalten von Bischof Hanke einzuordnen, sei daran erinnert, dass nach all den Missbrauchs-, Vertuschungs- und Machtskandalen die deutschen Bischöfe völlig erschöpft und ratlos waren, so dass sie einen einstimmigen Beschluss fassten, auf die „Laien“ aus den Diözesen und Verbänden zuzugehen. Sie baten sie, ihnen zu helfen, da sie aus eigener Kraft den Wandel hin zu einem kontrollierten Umgang mit Macht nicht schaffen. Der Synodale Weg war eine Initiative der Bischöfe. Sie haben zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken das aufgegriffen, was auch schon Wir-sind-Kirche 1995 vorgeschlagen hatte (die jetzt von Papst Leo nach Rom eingeladen wurden zu einem Treffen von Gruppen, die sich mit Synodalität beschäftigen). Vielleicht wäre es besser gewesen, der Synodale Weg hätte sich auf die Kernprobleme Macht, Transparenz, Kontrolle konzentriert, und die anderen polarisierenden Themen weggelassen. Zölibat und Frauendiakonat haben nicht zwingend mit dem Problem von Machtmissbrauch und Vertuschung zu tun, gaben aber Rechtskonservativen Anlass, bei den „Frommen“ gegen den Synodalen Weg auch mit Falschinformationen zu polemisieren.
Auf der März-Vollversammlung des Diözesanrates 2023 hat Bischof Hanke sich dazu erklärt. Ich habe mich gemeldet, wir würden jetzt zwar wissen, warum er den Synodalen Weg ablehnt; aber was habe er dann anzubieten an Lösungen für die Probleme des Vertuschens und des Machtmissbrauchs? Da kam dann überhaupt nichts. Und das geht in einer konstruktiven Kultur nicht mehr so wie früher: Es reicht nicht, dagegen zu sein. Ein Bischof von Eichstätt, so meine Erwartung, muss echte Lösungen für ein echtes Problem anbieten. Mit seinem Verhalten in der Causa Lentinger Ablassbrief demonstriert Hanke aber, dass es ihm mit seiner Ablehnung des Synodalen Weges wohl nicht um Theologie ging, sondern m.E. darum, eine regelbasierte Umgangskultur und kontrollierende Instanzen zu verhindern.
Unergründlich sind die Wege – der Staatsanwaltschaft
Wäre Hanke seinen grundlegenden Aufgaben als Bischof nachgekommen, – den Zeugen anhören lassen, seine Angaben überprüfen, Fakten sichern, – also den Vorwurf des Diebstahls nicht einfach stehen zu lassen, sondern intern zu klären, dann hätte es keine Staatsanwaltschaft gebraucht, ja der Fall wäre auch nicht öffentlich geworden. Im Nachhinein sieht es für mich so aus, dass der Weg über die Staatsanwaltschaft für ihn eine günstige Methode war, eine eigene Untersuchung zu vermeiden. Und gleichzeitig damit rechnen zu können, dass die Staatsanwältinnen die Ermittlung ohne echte Prüfung einstellen würden, etwa wegen der Aussage ehemaliger Mesner, da sei nie was gewesen. Hanke selbst hat sich nie zu dem Fall geäußert; stattdessen hat er nur auf den Archivar verwiesen (der ja keine Untersuchung anordnen kann), oder auf die Staatsanwaltschaft (die im Wesentlichen untätig blieb). Dabei könnte nur er etwas veranlassen oder ändern. Das ist ein Beispiel von vielen für das Verhaltensmuster von Gregor Maria Hanke, in denen er die Verantwortung nicht übernimmt für sein Amt oder für sein Handeln bzw. Nicht-Handeln, sondern sie weiterreicht an Untergebe oder andere.
Nachdem Hanke mir nicht antwortete, versuchte ich über die Presse zu erreichen, dass er den Fall aufklären lässt. Die Süddeutsche Zeitung schilderte am 6. Februar 2024 Stefan Weyergraf-Streits Aussagen ebenso wie Heigls „da war nie was“; Bischof Hanke ließ lediglich ausrichten, die Pfarrei Lenting habe alles richtig gemacht, und ich konnte loswerden, dass die Kirche wohl absichtlich wegschaue. Wegen der Nachfrage der SZ-Redakteurin kündigte die Ingolstädter Staatsanwaltschaft aber an, erneut zu ermitteln. Was dann passierte, ist eine „Black Box“.
Stefan Weyergraf-Streit wurde nun erstmals von einem Eichstätter Polizisten vernommen. Er konnte die Maße der Urkunde in ein Foto einzeichnen; der Polizist sagte, wenn die Wand manipuliert wurde und Zeugen Falschaussagen gemacht haben, dass diese Leute wohl wegen versuchter Strafvereitelung dran wären. Auch ich habe eine Vorladung zu dem ermittelnden Kriminalpolizisten Z. nach Ingolstadt bekommen. Er befragte mich zum möglichen Tathergang, zu dem ich ja nichts sagen kann, und das betonte der Vernehmer auch; so als ob er missmutig darüber sei, sich noch einmal mit dem Fall beschäftigen zu müssen. Er selbst gab zu, er müsse aufpassen, seine Fragen an mich neutral zu formulieren. Was ich aber kann, Zusammenhänge herstellen und Indizien verknüpfen, darüber wollte er gar nicht erst mit mir diskutieren. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass er mich als Gegner behandelte. Er sah mich nie an; nur einmal, als ich sagte, dass auch der Kirchenpfleger Amler sich an die Urkunde an der Wand erinnert, was ja zeige, dass eine schwarzgraue Tünche eine Lüge ist. Er wirkte auf mich, als hätte er sich vom Dorfpfarrer emotional beeinflussen lassen, etwa, der Händeler habe was gegen ihn und wolle ihm schaden.
Ich äußerte, wer hier die Wahrheit sage, das ließe sich schnell klären, wenn die Polizei die möglichen Spuren in der Wand – übertünchte Farbe, verfüllte Bohrlöcher – untersuchen würde. Nein, sagte der Kriminalpolizist Z., die Wand werde nicht untersucht, denn das würde ja nicht beweisen, was dort gehangen habe. Das stimmt nicht, antworte ich: Denn in Verbindung mit den Zeugenaussagen, die die historische Ablassurkunde an dieser Stelle gesehen haben, wäre beim Fund von Spuren klar, dass die Angaben von Pfarrer Heigl und seinen Mesnern unwahr sind. Geklärt wäre auch, dass die Angaben des Diözesanarchivars nur Interessen geleitete Spekulation waren. Da dieser mir die Recherche ausreden wollte, halte ich ihn nicht für neutral, sagte ich. Zur Klärung des Falls sollte die Staatsanwaltschaft daher Sachverstand von außerhalb hinzuziehen. Keine Antwort. Dass er ernsthaft ermitteln würde, danach hörte sich das für mich nicht an.
So kam es dann auch: Im September 2024 verkündete die Ingolstädter Staatsanwaltschaft, den Fall eingestellt zu haben, da kein Täter zu ermitteln sei. Ich schrieb an die Staatsanwältin und fragte, was sie bzw. was sie nicht untersucht habe, aber bekam einen Brief mit der kurzen Antwort, ich sei nicht auskunftsberechtigt. Das ist gegenüber einem Berufs-Journalisten, der seinen Lebensunterhalt als freier Publizist in der Öffentlichkeit verdient, eine interessante These.
Ein Redakteur von katholisch.de hat dann für mich nachgefragt. Die Ingolstädter Staatsanwältin begründete die Einstellung der Ermittlung mit den ehemaligen Mesnern, die aussagen, dort habe es nie eine historische Urkunde gegeben. Eine „augenscheinliche“ Betrachtung der Wand habe auch keine Anhaltspunkte ergeben. Außerdem meine der Diözesanarchivar, dass die Urkunde seit Jahrzehnten verschwunden sei.
Jetzt stelle man sich einmal vor, Staatsanwältin und Oberstaatsanwältin hätten im Studium in einer Prüfung so argumentiert. Oder das so im Referendariat als Lösung präsentiert. „Meinen Sie nicht“, hätte vielleicht der Prüfer gesagt, „dass das vielleicht der Sinn einer Manipulation der Wand ist, dass es eben so aussieht, als sei da nie was gewesen?“ Solange sie keine Spuren hat untersuchen lasse, könnte sie darüber gar nichts sagen. Also diese Punkte bekäme sie dann schon mal nicht.
Was der Archivar äußere, sei irrelevant, da nur eine unbrauchbare Vermutung. Auch er könnte in keinster Weise sicher sagen, ob die Urkunde zu einem bestimmten Zeitpunkt da war oder nicht. Außerdem ist er mit seiner Bagatellisierung der Urkunde und dem Versuch, dem Journalisten das Fragen auszureden, unter Verdacht, eine echte Untersuchung verhindern zu wollen und daher nicht verlässlich. „Und die Mesner: Haben Sie berücksichtigt, dass darunter eventuell Mittäter sein könnten oder engste Spezl des Pfarrers mit Gefälligkeitsaussage? Oder alte Leute, die sich einfach nicht mehr erinnern?“ Das könne sie in keinster Weise als Beweis werten, zumal sie ja alle Zeugen ausblende, die sich an die Urkunde erinnern. Und so hätte der Prüfer sie durchfallen lassen.
Stefan Weyergraf-Streit hatte mehrere Zeugen genannt, die den Ablassbrief aus Ihrer Messdienerzeit kennen, etwa Andreas Reischl aus Lenting oder Dr. Günther Schmidt aus Schäftlarn. Jemand aus dem Geschichtskreis schreibt mir, es sei doch erstaunlich, wie viele sich seit dem SZ-Artikel wieder an die Ablassurkunde erinnern. Dem SWS wird berichtet, dass bei einer Familienfeier in Lenting ein Älterer erzählt, wie der damalige Pfarrer Guttenberger in den 40/50er Jahren ihnen als Jugendlichen den Ablassbrief präsentierte und erklärte. Da haben ausgerechnet die Jungen auf der Familienfeier gesagt, das glauben sie jetzt nicht, denn sie könnten sich nicht vorstellen, dass der Pfarrer Heigl lügt. Ein anderer ehemaliger Messdiener sagt zu SWS, dass er die Urkunde natürlich auch kennt, dass er das aber niemals öffentlich sagen würde, schließlich müsse er hier am Ort mit den Alteingesessenen weiterleben. Davon habe auch ich einen Vorgeschmack bekommen in Mails. Zeugen, die die Urkunde kennen, hat die Staatsanwaltschaft nicht befragt.
Ich hatte mehrmals schriftlich – auch Bischof Hanke – vorgeschlagen, dass öffentlich nach Zeugen zu dem Ablassbrief gesucht werden sollte. Man hätte Anonymität zusichern können. Aber das taten weder Kirche noch Staatsanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem Problem mangelnder Kompetenz zu tun haben. Wer schon einmal erlebt hat, welchen Ermittlungsaufwand die Polizei betreibt, bei einem 2000-Euro-Lackschaden am Auto nach einem Ausparken, was sie dann an Überwachungskameras und sofortiger Spurensuche aktiviert, und das dann vergleicht mit dem, was Ingolstädter Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer historischen Quelle unternehmen, die von ideellem und einem hohen materiellen Wert ist, der wird wohl auch zu dem Schluss kommen, dass das in keinem Verhältnis steht. Jemand, der sich in der Diözese Köln damit befasst, meinte, die Urkunde könne fünf bis sechsstellig wert sein, und fügte hinzu, dass es für so ein handschriftliches, einzigartiges Stück keinen festen Preis gibt; ein US-Milliardär würde dafür vielleicht auch eine noch höhere Summe zahlen.
Eigentum des Allgemeinwohls?
Rein juristisch gesehen gehört die Ablassurkunde der Kirche. Wenn ihr etwas gestohlen wird, kann sie die Polizei bitten, den Diebstahl aufzuklären. Wenn in einem Fall, bei dem jemand aus der Kirche die Kirche bestiehlt, klar würde, dass die Kirche eigentlich kein großes Erkenntnisinteresse habe, was passiert ist, dann wäre es aus der Sicht des Staates selbstverständlich, die Schultern zu zucken und sich intensivere Ermittlungen zu sparen.
Die Frage ist aber, ob historisches Erbe nicht allen Bürgern gehört, also dem Allgemeinwohl. Wenn jemand am Marktplatz ein altes Fachwerkhaus besitzt, dann kann er es nicht einfach einreißen und durch einen Stahl-Glas-Betonbau ersetzen, dafür sorgt der Denkmalschutz. Wenn eine historische Urkunde, die grundlegend die Geschichte des Ortes erklärt und ein direkter Teil der deutschen Reformationsgeschichte ist, von jemanden aus der Kirche in irgendeiner Weise verloren oder gar zerstört wird, geht das nicht alle an?
Ich rief den für Kultusangelegenheiten zuständigen Ministerialrat an. Ob nicht der Staat von der Kirche verlangen können, zu klären, wo die Urkunde geblieben ist? „Da machen wir nichts“, sagte er, ohne überlegen zu müssen, denn es gibt dafür keine rechtliche Handhabe. Aber er half mir auf anderer Weise: Amtschef Thomas Schäfers hatte gesagt, der Fall Ablassurkunde ginge den Bischof nichts an, das sei allein Angelegenheit der Kirchenstiftung Lenting. Freundlich formuliert war das eine Nebelkerze, und schob Verantwortung weg. Der Ministerialrat bestätigte aber meine Vermutung, dass der Bischof bei der Kirchenstiftung selbstverständlich weisungsbefugt ist und auch ein Durchgriffsrecht auf das Vermögen der Kirchenstiftung habe. Dass der Bischof nicht verantwortlich sei, ist schlicht unwahr.
Dann habe ich mich an den bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume gewandt, weil er einschlägige Erfahrung mit Kirchenleuten gemacht hat, und der mich bei meiner Anfrage auch freundlich grüßen ließ. Er könne aber nichts tun, denn für „Kult“ ist die Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern zuständig, und leitete meinen Brief weiter. Derselbe Ministerialrat aus dem Kultusministerium, mit dem ich telefoniert hatte, schrieb mir, seitdem hätten sich die rechtlichen Verhältnisse nicht geändert. Wieder schrieb ich dem Wissenschaftsminister, ob die Politik so ein Fall nicht nur juristisch, sondern auch politisch sehen könne, um Aufklärung zu verlangen, wo eine historische Quelle geblieben ist? Sein Büro richtete mir aus, dass Blume die Kultusministerin darauf ansprechen würde, aber dann habe ich nichts mehr gehört. Ich meine, wäre Blume Kultusminister, dann hätte sich jetzt der Staat eingemischt. Dass das nötig ist und hilft, zeigen die verschärften Gesetze zur Aufklärung beim sexuellen Missbrauch.
Hinweisgeber persönlich abwerten
Untersuchungen der vergangenen 15 Jahre haben – über alle Diözesen hinweg, mit regionalen Unterschieden, – beim sexuellen Missbrauch ein Verhalten von Kirchenverantwortlichen festgestellt, das die Opfer bekämpft und die Täter schützt. Das ist der eigentliche Kirchenskandal. Was immer wieder in verschiedenen Versatzstücken und Ausprägungen vorkam: Dass sich ein missbrauchtes Kind an die Eltern wandte, aber die sich nicht trauten, gegen den Pfarrer vorzugehen. Dass es ausreichte, wenn der Pfarrer sagte, dass das nicht stimme. Dass Hinweisgebern und Opfern nicht geglaubt wurden, „Problem gelöst“, und alle Energie aufgewendet wurde, zu argumentieren, warum der Zeuge nicht glaubhaft sei, anstatt einfach mal dem nachzugehen. Und wenn das nicht reichte: Dass ihre Glaubwürdigkeit angegriffen wurde, versucht wurde, ihr Ansehen zu beschädigen, einen Gruppendruck zu erzeugen, sie aus der „Gemeinschaft“ auszuschließen. Das hatte m.E. ein Klima zum Ziel, in dem es gar nicht erst jemand wagen sollte, den Mund aufzumachen.
Stefan Weyergraf Streit kostete es großen Mut, auf seine Aussage zu beharren, dass er die Ablassurkunde gesehen hat, sie wenige Monate später verschwunden war und nun die Wand so manipuliert wurde, als ob es sie nie gegeben hätte. Es ist mutig angesichts seiner Eltern, die am Ort wohnen/wohnten, und auch weil er die Kontakte nicht verlieren wollte, um die Geschichte seines Heimatdorfes zu erforschen. Er wurde aggressiv angegangen, er solle endlich „Ruhe geben“. Und mit dem weiteren Verlauf wurde der Fall für seine Frau und seine schulpflichtigen Kinder so belastend, dass er beinahe selber Nichts mehr davon wissen wollte. Dann wäre die kirchliche Mischung aus Verschleppen, Ausgrenzen und Bedrohen an ihr Ziel gelangt.
So ein Konflikt kann nur aus der Welt geschaffen werden, in dem die Vorwürfe geklärt werden. Ein Bischof, der den Frieden sucht, der würde den Konflikt lösen, indem er die Wand untersuchen lässt. Dann wäre entweder SWS bestätigt worden, und das hätte Konsequenzen für den Pfarrer gehabt. Oder aber einem Fragesteller wie mir wäre die finale Antwort gegeben worden, dass Stefan Weyergraf-Streit, seine Frau und viele andere sich nur was ausgedacht haben. Aber selbst, wenn sich herausstellt, dass der Pfarrer die Wahrheit sagt, bleibt das eigentliche Thema, wie Kirche mit einem Verdacht umgeht.
Hier reichte es aus, Fragen zu stellen, um verächtlichen, bösen Blicken auf der Straße ausgeliefert zu sein. Oder statt überschwänglich freundlich nur noch kürzest knapp mit Eiseskälte oder gar nicht mehr gegrüßt zu werden. Eines der wichtigsten Erkenntnisse aus den vielen Skandalen der Kirche ist es doch, dass ein Klima geschaffen werden muss, in dem sich jeder trauen kann, seine Beobachtung oder sein Erleben mitzuteilen, jede mögliche Untat eines Kirchenmitarbeiters zu melden, ohne Angst vor Repression haben zu müssen oder ausgeschlossen zu werden. Weil die Täter dann wirklich wissen, dass sie nicht mehr geschützt werden. Weil dann Untaten nicht mehr unter der Decke bleiben. Weil alles in der Kirche sinnlos wird, wenn Wahrhaftigkeit nicht an erster Stelle steht. Denn ohne Wahrheit gibt es auch keine echten Beziehungen.
Fragen zu stellen, um den Konflikt zu lösen, das macht einen Menschen aus, der im Angesicht Gottes lebt. Ich schrieb Bischof Hanke, er könne Stefan Weyergraf Streit Lob dafür aussprechen, dass er auf das Verschwinden der Urkunde hingewiesen hat. Denn nur dann werden sich auch in Zukunft Menschen trauen, auf Missstände hinzuweisen. Und wie beurteilt er meine Rolle, eine Aufklärung zu versuchen: Bin ich ein Problem, ein Feind? Oder bin ich jemand, den er als Vorbild hinstellt? Ich habe keine Antwort bekommen.
Dafür bekam SWS und ich einen Brief von den beiden Vorsitzenden des Lentinger Pfarrgemeinderates, Angela Vogl und Gerda Amler. Sie hätten jetzt schon so viele E-Mails in der Sache schreiben müssen, dass sie nun einstimmig beschlossen hätten, sich einfach nicht mehr mit dem Fall beschäftigen zu wollen. Ich schrieb zurück, nicht die Masse an Mails sei entscheidend, sondern ob sie Relevantes unternehmen. Aber das haben sie ja nicht. Ich würde verstehen, wenn der PGR sagen würde: Wir haben keinerlei Befugnisse und können uns nicht gegen den allein verantwortlichen Pfarrer stellen, der keine Untersuchung wünscht und das Thema für erledigt erklärt. Das wäre in Ordnung. Der PGR hätte aber auch mal einfach ausprobieren können, was passiert, wenn er SWS einlädt, seine Erlebnisse zu erzählen. In den Laiengremien sollte sich jeder vergegenwärtigen, dass wir einst als Einzelperson für unser Tun werden Rechenschaft ablegen müssen. Nicht eine/r aus dem Lentinger PGR hat mal selber bei SWS nachgefragt, was er sagen möchte, ob man ihm helfen könnte oder wie sich der Konflikt beilegen ließe.
In diesem Brief schrieben die beiden PGR-Vorsitzenden auch: Ich würde eh nur Druck machen, weil ich was gegen den Pfarrer hätte. Auch ein Verhaltensmuster: Anstatt sich inhaltlich auseinanderzusetzen, dem anderen niedere Beweggründe zu unterstellen; das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Statt „Der Erik Händeler möchte die Aussagen von Stefan Weyergraf-Streit klären, auch weil es ihm um Wahrhaftigkeit in einer funktionierenden Kirche geht“, verbreitetet so ein Narrativ „Der hat halt was gegen den Pfarrer.“ Daher kamen die bösen Blicke. Weil ich bei einem ungeklärten Konflikt so nicht zum Helferkreis oder gar in den Gottesdienst gehen kann, habe ich im Dezember 2023 Bischof Hanke geschrieben, er möge einen Vermittler in die Gemeinde schicken, um den Fall zu klären – und bekam wie immer keine Antwort. Mit dieser letzten Mail gab ich es auf, dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke überhaupt zu schreiben: Ich meine, das gehört bei Leuten wie ihm zur Strategie, auf berechtigte, kritische Fragen einfach so lange nicht zu antworten, bis den anderen die Kraft verlässt. So werden auch Mitarbeiter und Ehrenamtliche konditioniert, was sie sagen und fragen dürfen und ab wann sie riskieren, ignoriert zu werden.
Dafür legte der Pfarrer und die beiden PGR- Vorsitzenden nach, mit zwei Artikeln im Pfarrei-Blatt im Dezember 2024. Ohne die Namen zu nennen, die ja sowieso in der Gemeinde und am Ort bekannt sind, bezeichneten sie SWS und mich als „Klageführer“, so als wenn wir den Pfarrer verklagt hätten. Dabei ist der eine Hinweisgeber und der andere jemand, der es für normal hält, Vorwürfe aufzuklären. Den Stefan Weyergraf-Streit, den relevanten Heimatforscher, nannten sie „einen ehemaligen Lentinger“, so als wenn er nicht ernst zu nehmen sei, wenn er nicht mehr hier wohne. Den „Klageerhebern“ ginge es nur ums „Recht haben“. Sie hätten „keinen Humor“. Also wieder: Herabwürdigungen ohne inhaltliche Auseinandersetzung, und Täter-Opfer-Umkehr.
Stefan Weyergraf Streit war sachlich und geduldig seiner staatsbürgerlichen Pflicht nachgekommen, auf das Verschwinden der Urkunde hinzuweisen. Der Pfarrer rief nicht zurück, der Pfarrgemeinderat wollte ihn nicht hören, und hat per Brief mitgeteilt, sich gar nicht damit befassen zu wollen; das Treffen in der Kirche war ein Brüllen und Leugnen des Pfarrers ohne Klärung von Details; der Bischof hat nicht geantwortet, die Staatsanwaltschaft nichts Wesentliches zur Aufklärung beigetragen. Und was schreiben die beiden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden in dem Pfarrei-Blättchen? Eine „gelingende Kommunikation“ sei gescheitert an fehlender „Fairness, Sachlichkeit und Respekt“ von den „Klageerhebern“. Das haben die frei erfunden. Es gab keine Kommunikation, weil der Pfarrer/Bischof/PGR jede Kommunikation unterband.
Bemerkenswert ist auch ihr Satz, „derartige Anschuldigungen gegenüber Haupt- und Ehrenamtlichen der Kirche“ seien „Wasser auf die Mühlen von Kirchenkritikern“. Wer also auf eine mögliche Straftat hinweist, der schade der Kirche, behaupten Angela Vogl und Gerda Amler. Diese Aussage unterstützt das bekannte Klima, in denen Pfarrer handeln können, ohne überprüft oder kritisiert zu werden. Und sie entmutigt Betroffene, Hinweise auf Missstände und Straftaten offenzulegen – weil das ja angeblich der Kirche schade. In Wirklichkeit ist es umgekehrt so, dass nicht das Aufklären von Vorwürfen der Kirche schadet, sondern – wie der Umgang beim sexuellen Missbrauch die Unkultur der Kirche gezeigt hat – das Vertuschen von Missständen. Der Satz zielt außerdem darauf ab, sozialen Druck am Dorf aufzubauen, das Verschwinden der Ablassurkunde nicht weiter zu thematisieren.
SWS schrieb an Angela Vogl, sie solle ihre falsche Darstellung und abwertenden Bemerkungen zurückziehen. Keine Reaktion von ihr, die vorher zum „Scheitern der gelingenden Kommunikation“ behauptet hatte – siehe oben. Jetzt schrieb ich einen Brief an Pfarre Heigl/Vogl/Amler, in dem ich mich ausführlich mit ihrer Falschdarstellung und Ehrverletzenden Bemerkungen auseinandersetzte. Jeder, der von einem Bericht betroffen ist, hat das Recht, im selben Medium an vergleichbarer Stelle sich artikulieren beziehungsweise etwas richtigstellen dürfen, das ist ein Rechtsgrundsatz. Doch mein Brief war nicht juristisch, sondern eine Vorlage zur inhaltlichen Auseinandersetzung, eine Aufforderung zur direkten Klärung. Unsere Gegendarstellung sollte im Info-Kasten vor der Kirche und auf der Webseite im Internet veröffentlicht werden.
Was zurückkam, war eine juristische Stellungnahme, warum Fristen versäumt wurden und kein Anspruch auf eine so ausführliche Gegendarstellung bestünde. Die vom Kirchensteuerzahler finanzierte Rechtsabteilung im Ordinariat wurde dafür genutzt, einem kirchlichen Amtsträger zu ermöglichen, eine inhaltliche Auseinandersetzung zu umgehen. Die Chance auf ein Gespräch und eine Klärung hat die Kirche damit erneut abgelehnt.
Im politischen Gemeinderat gab es niemanden, der mal nachfragen wollte, wo die Urkunde hingekommen ist, was mit personellen Überschneidungen zu tun haben könnte. Vielleicht macht es bei der im März anstehenden Kommunalwahl einen Unterschied, welche Fraktion die Frage beantwortet, wie der Ort mit den Zeugnissen seiner Geschichte in Zukunft umgehen möchte. Das allermeiste Material zur Geschichte Lentings hat sowieso Weyergraf-Streit erarbeitet, deswegen könnten sie ihn auch zum Ehrenbürger ernennen. Und damit ein bisschen davon wieder gut machen, dass ihm niemand geholfen hat.
Einschüchterungsversuche mit juristischen Drohungen
„Falls weiterhin irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden sollten oder Verleumdungen gegen Personen ausgesprochen werden“, schreibt mir Pfarrer Heigl auf mein Nachfragen im Oktober 2023, würden die betreffenden Personen sicher die „nötigen rechtlichen Schritte“ einleiten. Ja, sehr gut, schrieb ich zurück, das ist doch das, worum es geht, dass endlich aufgeklärt wird (die Staatsanwaltschaft hatte damals zum ersten Mal nach Nichtstun die Ermittlungen eingestellt). Er solle doch Anzeige erstatten gegen Stefan Weyergraf-Streit. Dann würde eine Untersuchung der Wand ja zeigen, wer die Wahrheit sagt. Keine Rückmeldung. Aber das Schema scheint mir klar: Kommunikation verweigern, aber mit nebulösen juristischen Schritten drohen, um jemanden einzuschüchtern, seine Beobachtung weiterhin zu erzählen. Oder Fragen zu stellen.
Schon beim Gespräch des Diözesanratsvorstandes im Dezember 2023 mit Bischof und Amtschef hatte Amtschef Thomas Schäfers gesagt, der Händeler müsse aufpassen, nicht juristisch belangt zu werden. Als ich ihn anmailte, was ich mir denn habe zu Schulden kommen lassen, was juristisch belangt werden könne, antwortete er nicht darauf, sondern ging auf mich los, aus Transparenzgründen müsse ich ihm die Namen derer nennen, die das gesagt haben. Ich schrieb, dass er Angst verbreiten will, nannte aber die Namen und fragte erneut nach, was ich Justiziables getan haben sollte. Er wand sich wortreich heraus: Richtig sei, „dass ich in der Vorstandssitzung darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich durchaus Grenzüberschreitungen erkenne, wenn beispielsweise Aussagen über Mitarbeitende des Hauses getroffen werden, die möglicherweise geeignet sind, den Eindruck zu wecken, sie würden nicht sachgerecht arbeiten oder Interessedaran haben, Sachverhalte zu verschleiern.“ Ja selbstverständlich sollte man das öffentlich benennen, wenn Kirchenleute „nicht sachgerecht arbeiten“ oder möglicherweise etwas vertuschen, wenn es dafür gute Argumente gibt, was denn sonst? Es ist ja wohl nicht per se justiziabel, einen Verdacht zu äußern und deshalb Aufklärung zu verlangen.
Ebenso erging es mir mit dem Generalvikar Alberter, als ich im September 2024 erfolglos versuchte, den Fall beim Diözesanrat ins Gespräch zu bekommen (siehe weiter unten beim Thema Gremien). Als mir der Vorsitzende Christian Gärtner das Wort entzog, rief mir Alberter halblaut zu, „das können wir ja auch juristisch klären“. Draußen vor dem Saal sagte er mir hinterher: „Ich werde jetzt nicht mit Ihnen über den Fall reden. Sie wissen ja sicher, warum.“ Das wirkte auf mich erneut wie eine juristische Drohung. Und das ist der Punkt: In einer funktionierenden Kirche werden Konflikte per Gespräch ausgetragen. Und wenn es schwieriger wird: Mit Vermittlern von außen, von einer anderen Diözese oder der Nuntiatur.
Im Übrigen ändere ich diesen Text gerne, wenn jemand mich davon überzeugt, dass ich falsch liege; und diese Webseite verschwindet, wenn die Diözese ins Handeln kommt. Dass es sie überhaupt gibt, ist kein Kompliment für Eichstätt – denn in einer redlichen Kirche gäbe es erstens Foren für Gespräche, und zweitens unvoreingenommene Untersuchungen. Auch die vielen „möglicherweise“ und „meine ich“ die ich hier einfüge, sind dem Skandal geschuldet, dass jemand, der Missstände benennt, damit rechnen muss, dass einem die Bistumsleitung mit Verleumdungsklagen oder Unterlassungserklärungen zusetzt, anstatt sich inhaltlich auseinanderzusetzen. Das bestätigen auch die nicht wenigen Geschichten von juristischen Auseinandersetzungen, die die Bistumsleitung mit Mitarbeitern führt(e). Das könnte eingehegt werden, wenn die Bistumsleitung in Zukunft erst dann einen Prozess anstrengen kann, wenn sie davor von einem Diözesangremium grünes Licht dafür bekommen hat. Ein neuer Bischof von Eichstätt muss sich also entscheiden, ob er so weiter macht wie die bisherige Bistumsleitung. Oder ob er klarstellt, dass aus der Sicht des Evangeliums Einschüchterungen mit juristischen Drohungen völlig inakzeptabel sind, um Kritiker oder Aufklärer abzuwehren; und dass sie Kritik inhaltlich zu begegnen haben.
Das gilt für den kommenden Bischof bei allen Themen: Schauen wir uns an, welche m.E. desaströsen Entscheidungen Bischof Hanke fällte, und warum das mit seiner Nicht-Kommunikation zu tun. Sein Konzept „Ich alleine-bin-Kirche“, mit dem er beratende Gremien kaltgestellt hat, führt zu einem Wahrnehmungsverlust der breiten Wirklichkeit, und zu großen materiellen und immateriellen Schäden. Daraus ist zu lernen, für eine neue Art des Zusammenwirkens mit einer neuen innere Umgangskultur.
Missmanagement
Die von außen erkennbaren Einzelkrisen der Diözese Eichstätt haben eine gemeinsame, innere Ursache: Ein Hierarchisches Top-Down-Management kommt mit der modernen Komplexität und Dynamik nicht mehr mit. Doch die nötige Netzwerk-Struktur, die das Ziel christlicher Entwicklung ist, hat Bischof Hanke verhindert. Und so fehlt ein produktives Miteinander. Hankes Unwillen, Probleme anzugehen, führte zu einem Entscheidungsstau mit einem 2023 nicht mehr genehmigten Haushalt, auf die er mit einem nicht ausgereiften Rundumschlag reagierte. Die Schulen öffentlich zum Verkauf anzubieten, ohne einen Käufer zu haben, verschreckte Schülereltern und ließ auch junge Lehrer an staatliche Schulen flüchten. Die drohende Säkularisierung der Franziskanerbasilika zeigte, dass er noch nicht einmal darüber nachdenkt, die Gläubigen oder die Bürger um Hilfe und um Ideen zu bitten. Wer Geld geerbt hat, kann nichts spenden, weil er oder sie nicht wissen kann, wo die Kirche Geld braucht. Das Diözesanbauamt – seit Karl Schattner und seinen Nachfolgern von deutschlandweitem Renommee – hat er zusammengekürzt, so dass nun externe Architekten Aufträge erledigen, die aber vermutlich teurer sind, und den Schaden durch abgeflossenen Sachverstand nicht ersetzen können, sagt mir ein Beamter eines städtischen Bauamtes. Keinem rationalen Plan zu folgen scheint – angesichts von schrumpfenden Mitteln – der weitere Stellenaufbau. Auch die Dekanatsbüros und die Jugendstellen aufzulösen, anstatt ergebnisoffen über Veränderungen beraten zu lassen, halte ich für einen furchtbaren Missgriff, weil jetzt in der digitalisierten Welt mehr denn je klar wird, dass Kirche aus lebendigen Bausteinen besteht. Und diese Beispiele ließen sich fortführen. Ein neuer Bischof von Eichstätt sollte eine neue, klare Linie vorgeben, in alles zu investieren, was mit Menschen zu tun hat, und sich des Betonballastes entledigen.
Warum dieses Missmanagement kein fachliches, sondern m.E. ein moralisches Problem sind, zeigt exemplarisch der Fall des Zig-Millionen-Verlustes in den USA. Vordergründig ist es wahrscheinlich so, dass ein stellvertretender Finanzchef der Diözese 60 Millionen Dollar in ungesicherte Immobilienkredite angelegt hat, und dabei auch Korruption mit im Spiel sein könnte (der Prozess ist eröffnet, aber die erste Hauptverhandlung steht erst bevor). Es gab Rückflüsse, aber dazu gezählt werden auch versprochene Ratenzahlungen über mehrere Jahre in der Zukunft sowie Immobilien, von denen keiner sicher weiß, was die mal einbringen. Das Bistum hat meines Wissens in seiner Bilanz den gesamten ausstehenden Betrag (etwa 54 Millionen USD) als Verlust abgeschrieben, solange keine sicheren Rückzahlungen garantiert sind. Dazu kommen noch viele Millionen für Anwälte, Gutachten, Verwaltung als Schaden hinzu.
Das ist m.E. keine plötzliche kriminelle Tat, die zufällig über die Kirche von Eichstätt hereingebrochen ist. Sondern auch die Folge von intransparenten Strukturen und einer Reihe von Fehlentscheidungen, die Bischof Hanke zuvor getroffen hat. Wäre er ein Umweltbischof, dann hätte er das Geld in Solarparks investiert. Und hätte er die Gremien gefragt, wofür wir investieren sollten, dann hätte ich dafür gestimmt, Obdachlosenheime und Sozialwohnungen zu bauen. Da hätten wir als Kirche Gutes tun können und gleichzeitig einen beständigen Wert für die Zukunft gesichert. Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 hätte auch über Predigten hinaus klar sein müssen, dass Investmentbanker in einer Kirche nichts zu suchen haben.
Noch 2018 gab es einen kaufmännischen Mitarbeiter, der für die Diözese und unter der formalen Hierarchie eines teilweise kenntnislosen Domkapitulars die Arbeit als Finanzverantwortlicher machte. (Dass er hier seinen Namen nicht lesen möchte, gehört zu dem eigenen Kapitel, wie diese Bistumsleitung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen ist.) Er wurde 2018 unter Druck dazu gebracht, den Arbeitsvertrag „einvernehmlich“ aufzuheben, ohne dass für ihn und andere Umstehende ein nachvollziehbarer Grund vorlag. Der Investmentbanker, der später den Schaden verursachte, schwirrte damals schon in Eichstätt umher. Ich habe hautnah miterlebt, wie die plötzliche Wegnahme des Arbeitsplatzes den Familienvater mit schulpflichtigen Kindern zwang, sich beruflich neu aufzustellen – sie mussten schließlich nach Berlin ziehen. Verbittert hat ihn, dass es – so seine damalige Aussage – nicht wirklich eine Begründung dafür gab, ihn abzusetzen. Kurz darauf kam der Investmentbanker.
Laut Bischof Hankes Erzählung habe ihn eine unabhängige Findungskommission eingestellt. Doch ich gehe davon aus, dass die Mitglieder der Kommission sehr wohl wussten, dass der Banker vor Jahrzehnten einige Zeit im Noviziat mit Bischof Hanke verbracht hatte, und dass sie sich so nahestehen, dass Hanke sogar Taufpate seines Kindes ist. Wer würde es wagen – man denke an die engen Abhängigkeiten im Kirchenapparat – den Kandidaten nicht einzustellen? Und wer würde sich trauen, Kopf und Kragen zu riskieren, dem Bekannten vom Bischof beim Arbeiten in die Karten zu sehen? Stimmt die Behauptung, Hanke habe seinem Investmentbanker ein Renditeziel vorgegeben? In einer Zeit der Nullzinsen? Und dafür soll dann das Domkapitel verantwortlich sein?
Anstatt sich als Opfer darzustellen, hätte Bischof Hanke Verantwortung übernehmen sollen für seinen Part an der Geschichte. Niemand hat den Banker kontrolliert, Entscheidungen fielen im Hinterzimmer. Bis heute wird der Diözesanrat oder das Domkapitel nicht gefragt, wie Kapital einzusetzen ist. Wenn jemand anderer Bischof von Eichstätt gewesen wäre, der Investmentbanker wäre m.E. nicht eingestellt worden. Und er wäre von Kollegen kontrolliert worden, was man bei einem Freund vom Bischof eher nicht so offensiv tut. Ob Bischof Hankes Angabe stimmt, dass er nicht wusste, wohin das Geld geflossen ist, oder doch, wie auch im Bistum gemurmelt wird, kann ich nicht beurteilen. Doch ich finde beide Versionen schlimm und kann kaum sagen, welche der beiden Versionen gruseliger ist. Auf den Punkt gebracht haben wir als Diözese Eichstätt einen unvorstellbar hohen Betrag von 30 bis 40 Millionen Euro verloren, weil sich Gregor Maria Hanke gegen eine Evangeliums gemäße Weiterentwicklung von Kirche stellte.
Nicht-Kommunikation
Die Lösung für all diese Probleme ist eine völlig andere Kommunikation als bisher. Denn Reden hilft. Und zwar nicht erst wenn Gläubige austreten (das Gespräch dazu bietet die Pressestelle seit zwei Jahren an), sondern vorher im laufenden Betrieb. Wie viele Ideen und Verbesserungen und wie viel Engagement entgehen uns, weil die Kommunikation nicht gut ist? Weil die Menschen nicht gefragt werden? Was die Diözese Eichstätt erlebt hat an nicht zu Ende gedachten Entscheidungen und ihrer Rücknahme oder Relativierung, die Informations-Desaster bei der öffentlichen Vermittlung (Schulen, Krankenhausseelsorge, St. Monika,…), die Unsicherheit für die Mitarbeitenden, die vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, und Unklarheiten beim Stellenumbau im Ordinariat wie in der Diözese („Pool“) – das alles wäre so nicht geschehen, gäbe es eine besser funktionierende, wechselseitige Kommunikation zwischen allen Bereichen der Kirche und ihrer Leitung. Bisher wurde alleine oder im kleinsten Kreis entscheiden; Würden im Vorfeld das Wissen und Potenzial vieler genutzt, wäre die Analyse näher an der Wirklichkeit, mehr Lösungsmöglichkeiten würden erdacht werden, und Entscheidungen der Bistumsleitung würden von einer Breite der Gläubigen mitgetragen werden als oftmals nur kopfschüttelnd und ohnmächtig rezipiert.
Wie Kommunikation verläuft, bestimmt der Bischof. Vor allem wenn er eine hierarchische Form wählt, die er kontrollieren kann, und alles, was außerhalb davon ist, ignoriert. Jeder Organisationspsychologe weiß: Dabei geht es um Macht. Schon wenn ich ein Unternehmen betrete und die Mitarbeitenden erlebe, ahne ich nach Sekunden, welchen Umgangston der Chef setzt. Und so hängt Kommunikation auch in einer Diözese vor allem von unsichtbaren Machtstrukturen ab, von unausgesprochenen Interessen, vom Verhalten eines Bischofs: Wer wird gefragt? Wer informiert? Wer wird gehört? Das entscheidet darüber, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerlich kündigen, Ehrenamtliche sich zurückziehen und Gläubige aus der Kirche austreten. Oder bleiben und sich in Zukunft engagieren, um das Evangelium mit dieser Institution in die Welt zu tragen. Die Wirkmächtigkeit eines Mitarbeiters oder Ehrenamtlichen sollte nicht von der Nähe zum Ohr des Bischofs abhängen.
Wenn jemand vor 20 Jahren einen Vortrag hielt bei einem Sparkassen-Neujahrsempfang, gab es anschließend Applaus und dann Buffet. Wenn ein Redner heute dort auftritt, bekommt er kaum die Hälfte der früheren Redezeit. Der Rest steht nun für Statements aus dem Publikum, Verständnisfragen und Kritik zur Verfügung. Erst dann versteht der Redner, was bei den Leuten hängengeblieben ist von dem, was er gesagt hat; wo er missverstanden worden ist oder wo er an der sozioökonomischen Gruppe vorbeigeredet hat; und wo andere ihre Probleme auf das Gesagte projizieren – um dann das Gespräch zu nutzen, seine Botschaft zu setzen. Bei größeren Veranstaltungen sammeln inzwischen Moderatoren die Fragen und Kommentare ein, die die Zuhörer per Handy auf die Internetplattform tippen. Durch Corona und die seitdem eingeführten Webinare hat sich das noch verschärft: Während ein Referent redet, ploppen auf seinem Schirm die Kommentare der Zuhörer auf, die begeistert, abfällig oder fragend sein können. Dadurch kann sich der Referent in Echtzeit an die Situation anpassen; außerdem lernt er ständig über seine Zuhörer dazu, um sein eigenes Weltbild der Wirklichkeit anzunähern. Das ist die Kommunikationsstruktur, die sich durch den technischen Wandel auch kulturell geändert hat: Ein Bischof – und der in 100 Jahren weiß das – geht in die Konflikte und nutzt diese, andere im Gespräch zu überzeugen, auf Augenhöhe, in Rede und Gegenrede.
Statt der Stichwortgeberin-YouTube-Videos würde sich in einer idealen Welt ein Bischof von Eichstätt mit jemanden unterhalten, der ein Glaubensproblem hat, der von Verwaltungshandeln aufgebracht ist oder ihn persönlich kritisiert, und davon könnte die Pressestelle dann den Link von einem lebendigen Gespräch in einer Presseinfo verbreiten, bei dem der Bischof seine Position erklärt. Auf den großen Management- und Branchenkongressen ist es normal geworden, dass ein Redner eine „Bestellung an das Universum“ abgibt oder vom Karma spricht; unvorstellbar, Gott zu erwähnen, so sehr haben die Kirchenleute in den vergangenen Jahrzehnten die Lebenswirklichkeit des Berufsalltags mit ihrer anderen Art der Kommunikation ignoriert. Solche Redner, die ja ihre Weltsichten und die damit verbundenen Werte verbreiten, haben mit ihren Beiträgen 100.000e, ja Millionen Klicks. Die Video-Beiträge von Bischof Hanke haben so 400 Klicks, wobei der Beitrag über seinen Hund immerhin schon 1800 Leute angeschaut haben. Ist das aussagefähig? Selbstverständlich! Es zeigt, dass er weder die Themen der Leute aufgreift noch deren Sprache spricht noch auf sie zugeht und sich auch keinen öffentlichen Kontroversen stellt.
Bei der Herbst-Vollversammlung des Diözesanrates 2023 blieb der Bischof mit Amtschef und GV zusammen, anstatt sich unter die Leute zu mischen und möglichst viele Gespräche zu führen. In einer lebendigen Kirche würde er von Tisch zu Tisch gehen, um möglichst vielen die Chance zu geben, ihn anzusprechen und ihm etwas aus dem realen Leben zurück zu spiegeln. Ein Priester erzählte mir, dass er mit dem Bischof in einer Gruppe verreiste, der Bischof ihn aber nie ansprach oder fragte, etwa wie es ihm in seiner neuen Stelle gehe, selbst nicht, wenn sie nebeneinanderstanden.
Vor mehr als zehn Jahren dufte ich mal bei einem Abend-Imbiss Bischof Hanke meine Ideen vorstellen, warum Wissensarbeit eine Chance für das Evangelium sein kann – wort- und regungslos hörte er zu, blieb stumm, begleitete mich zur Tür. In einer funktionierenden Kirche würde der Bischof Verständnisfragen stellen, und Rückfragen; er würde zusammenfassen, was er verstanden hat, er würde widersprechen; selbst, wenn er nichts damit anfangen kann, würde er es rückmelden. Es gab kein Gespräch, keinen Austausch.
Auch bei meinem Diag-Vortrag, beim Jubiläum der Mitarbeitervertretung im Juni 2022, sprach ich darüber, wie die Wirtschaft durch Umgang mit Wissen in die gedachte Welt hineinwächst, durch Entwicklung, Beratung, Problemlösung, Forschung, Bildung, Unterhaltung. Den Bedrohungen durch Erderhitzung und Flüchtlingsströme sind nur mit Hilfe einer weit höheren Produktivität zu begegnen. Wenn in Sub-Sahara ein Drittel der Ernten verrotten, dann braucht es ein Mehr an Wirtschaft, etwa Kühlketten und Solarenergie. Wenige Tage später predigte Bischof Hanke im Münster gegen Wachstum, so wie man sich die Welt damals in den späten 1980er-Jahren gedacht hat, als hätte er meinen Vortrag nicht gehört. In einer funktionierenden Kirche würde der Bischof direkt dem Vortragenden eine Rückmeldung geben. Wenn unterschiedliche Standpunkte nicht abgeglichen werden und man nicht voneinander lernt, dann ist eine lebendige Kirche unmöglich.
Auch redet der Bischof an der Situation vorbei. Im März 2023 kamen die plötzlichen Kürzungen und der sogenannte „Zukunftsplan“ über uns hereingebrochen. Gespannt warteten auf der Vollversammlung des Diözesanrates alle, was der Bischof dazu sagen würde. Doch stattdessen sprach er darüber, warum seine oft kritisierte Konzentration auf Umweltthemen richtig sei – ich habe nie eine Rede gehört, die weniger Gespür hatte für die Bedürfnisse des Augenblicks. Oder seine Ansprachen auf den Neujahrsempfängen: Sie wären für einen Bischof normalerweise eine große Chance. Er könnte werben für seine Ziele, ja die Leute dafür begeistern.
Er könnte schmerzhafte Veränderungen begründen; er könnte offene Fragen anstoßen, die Mitarbeiter, Ehrenamtliche und gesellschaftliche Institutionen mit ihm zusammen durchdenken sollen; er könnte auf öffentliche Kritik an ihm eingehen und versuchen, die Leute von sich und seinen Plänen zu überzeugen. Stattdessen beschrieb Bischof Hanke die Weltlage mit Hilfe des allgemein bekannten Tagesschau-Wissens, garniert mit zwei oder drei Kalendersprüchen, blutleer, und ohne konkreten Bezug zu den Anwesenden und den Problemen seiner Diözese. Das waren viele Worte, aber im Grunde eine Kommunikationsverweigerung. Widerholt rief er dazu auf, sich nicht mit Strukturfragen zu beschäftigen, sondern den Glauben in die Welt zu tragen. Dabei drückt genau die Art, wie sich jemand verhält, und wie Strukturen aufgebaut sind, den Glauben aus.
Die Kommunikation steht im Zentrum der notwendigen Reformen. Das ist die Zukunft der Kirche: Wenn ich am Sonntagabend nach dem Gottesdienst im Ingolstädter Münster zur anschließenden After-Mass gehe, unterhalte ich mich mit Katholiken und Katholikinnen / Christen und Christinnen / Menschen aus aller Welt über Gott und die Welt – Kirche ist Beziehung, das geht über Kommunikation. Gemeinden an Orten, die lediglich die Hackordnung des alten Dorfes abbilden, sind dagegen nur deren Sterbe-Hospiz.
Mitmach-Kirche
Für eine der wichtigsten Aufgaben eines neuen Bischofes halte ich es, die Menschen einzuladen, mitzumachen. Das geht nicht mit Befehl und Gehorsam, und das funktioniert auch nicht mehr mit festen Vorgaben. Der Pastoralreferent Thomas Schrollinger hatte 2018 die Initiative ergriffen und Haupt- und Ehrenamtliche versammelt, um in ihrer Freizeit darüber zu reden, wie man Kirche besser machen kann. Sie haben u.a. einen Krimi-Gottesdienst gestaltet sowie ein Fragekarten-Set entworfen und verbreitet, um die Gläubigen in lebendigen Austausch zu bringen: Was ist die wichtigste Zeile im Vaterunser für Dich? Macht Gott Fehler? Was genau war nochmal die Frohe Botschaft? Hinter dem Fragenkarten-Set steht die Erkenntnis, dass sich Glaube am besten im Gespräch weitergeben lässt.
In einer lebendigen Kirche würde der Bischof so eine Initiative von unten, die kein Geld kostet, in einer Predigt aufgreifen, um sie in seinem Bistum bekannt zu machen. Und um auch andere zu ermutigen, Ideen einzubringen. Doch in einer hierarchischen Struktur stören Eigeninitiative und Ideen nur. In einer Netzwerkstruktur würde der Innovationskreis ein gegenseitiges Lernen anstoßen. Es gab zwar Geld für einen Innovationsfonds, es gab zwei Inno-Tage, aber das ist eher ein Gewähren-Lassen anstatt aus so einer Ressource etwas zu machen und zu gestalten. Als der Diözesanrat im Herbst 2024 eine Resolution verabschiedete, die Initiative weiterzuführen, hat Hanke es ignoriert. Die wie so oft unausgesprochene Botschaft des Bischofs Hanke an den „Rest“, die ich verstanden habe, war: Denkt Euch bloß nichts aus, das wird eh nichts.
Meine letzte Firmgruppe, die ich begleitete, ohne eigene Kinder, waren Jungs aus Hepberg. Die wichtigste Jugendarbeit am Dorf ist inzwischen die der Feuerwehr, denn da rührt sich was. Kirchliche Jugendarbeit, früher in den 80er und noch in den 90er Jahren lebendig, gibt es fast nicht mehr. Weil die Angebote, meine ich, nicht zu den heutigen Bedürfnissen passen. Deswegen habe ich mit meinen Firm-Jungs auch Persönlichkeitstests gemacht, Stärken identifizieren; klären, wie Inhaltsorientiert jemand ist, wie Menschen bezogen oder wie umsetzungsstark. Weil es in der Wirtschaft darum geht, Teamarbeit produktiv zu gestalten, investieren Unternehmen darin. Hier läge auch eine Chance für die Kirche, Bewusstsein zu schaffen für die individuell von Gott gegebenen Gaben, die es ergänzend zu den anderen für das Gemeinwohl einzusetzen gilt. Aber es interessiert keinen. Es gibt in der Kirche weder eine Möglichkeit, Ideen anzubringen, noch gibt es eine Kultur, sie aufzunehmen und konstruktiv zu verarbeiten. Im Gegenteil: Ideen können sogar als Kritik aufgefasst werden, mit Konsequenzen für die eigene Stelle. Das erzeugt eine Kultur der Ängstlichkeit, in der sich niemand mehr traut, sich zu bewegen.
Als ich im Mai 2024 beim Klerusverein Bayern sprach und das erzählte, sagte ein Priester, er würde sich ganz genau so verhalten, und Initiativen der Gläubigen ablehnen. Und zwar weil alle Initiativen am Ende immer an ihm hängenbleiben würden. Diese Anekdote zeigt, warum die Kirche so schwach ist: Weil sie mit ihrer hierarchischen Struktur in einer dezentralen, multipolaren Gesellschaft nicht mehr lebendig sein kann. Erst wenn der Pfarrer zwar leitet und der Eucharistie vorsteht, aber Verantwortung abgibt, sodass nicht alles an ihm hängt, werden Ideen fruchtbar werden, kann sich das Denken, Fühlen und Erleben des Evangeliums frei entfalten. Während etwa in München Ehrenamtliche ausgebildet wurden, Wort-Gottes-Feiern in den Gemeinden auch am Sonntag zu halten, wo kein Priester mehr kommen kann, lehnt Eichstätt das ab: Die Diözese hat zwar auch ein paar wenige Wort-Gottes-Leiter ausgebildet, aber nur für den Werktag. So verhindert sie Glaubensleben.
Ein neuer Bischof sollte ergebnisoffen die Menschen miteinbeziehen. Das 1700-Jahre-Jubiläum des Konzils von Nicäa hätte eine große Chance geboten, die verschiedenen christlichen Gemeinden zu vernetzen; und auch in der eigenen Kirche das Bewusstsein für den damaligen Aufbruch zu nutzen für die aktuellen Veränderungen. Bischof Hanke hätte die anderen Geschwisterkirchen anschreiben und fragen können, wie sie sich eine gemeinsame Veranstaltung vorstellen. Er hätte mal die für das Stadtgebiet in Ingolstadt zuständige Cityseelsorge fragen können. Stattdessen hat er eine Frontal-Vortragsveranstaltung mit zwei Professoren von der Uni Eichstätt veranstalten lassen, für deren Ausführungen ein Grundstudium in Philosophie hilfreich, wenn nicht gar nötig gewesen wäre. Teilnehmer, die ich abends nach dem Münster-Gottesdienst traf, waren sowohl geistig als auch geistlich völlig erschöpft. Statt den Menschen Energie zu geben, wurden sie ausgesaugt. Anstatt etwas Lebendiges zu ermöglichen, hat Bischof Hanke eine Veranstaltung für pensionierte Lateinlehrer organisieren lassen. Und selbst die waren am Ende ratlos. Anstatt die anderen christlichen Gemeinden miteinzubeziehen, lud er sie zwar ein, aber wunderte sich, dass niemand kam. Direktiven von oben zerstören jede Eigeninitiative.
Ja, ich bin ein Kritiker von Bischof Hanke an dem, was er getan hat, und noch mehr an seinem häufigen Nicht-Handeln. Doch sein größtes Versäumnis sehe ich in all dem Guten und Lebendigen, das er nicht ermöglicht hat. Eine Mitmach-Kirche wird eine andere Umgangskultur benötigen als bisher.
Kritik üben, freie Rede
Reden tun die Leute sowieso – aber reden sie wegen ihrer Ohnmacht hinter dem Rücken des Bischofs, oder reden sie mit ihm? Der Bischof, den wir in 100 Jahren haben werden, der wird vor seinen organisatorischen Entscheidungen die Kirchenmitglieder beteiligen, er wird jeden noch so zunächst abwegig erscheinenden Vorschlag anhören lassen, damit er weiterentwickelt werden kann, und dankbar sein für Kritik. „Gemeinsam Kirche sein“ funktioniert nur, wenn Kritik und Gegenrede möglich sind, ohne dass jemand das Gesicht verliert, Angst haben muss vor beruflichen Konsequenzen oder als „der Böse“ sozial isoliert wird. Ein Bischof wird nur dann ein guter Bischof sein, wenn er Kritik zulässt und sich inhaltlich auseinandersetzt, um die anderen zu überzeugen, anstatt ein Machtwort zu sprechen, das er dann nicht erklärt.
Eine im Kirchenapparat relevante Person sagte mir, dass sie wegen der Kürzung des sog. „Zukunftsplans“ dem Bischof einen kritischen Brief geschrieben hat – und seitdem nicht mehr gefragt oder bei Entscheidungen hinzugezogen wurde. Auch ich habe schon im Juli 2024 meine Kritik und Vorschläge in einem Essay zusammengefasst, „Was erwarten die Gläubigen von einem Bischof von Eichstätt?“, und habe ihn über den Amtschef an Bischof Hanke geschickt. Der hätte differenziert antworten können, wo er sich ungerecht gesehen fühlt oder welche Vorschläge er aufnehmen würde. Stattdessen: Keine Reaktion. Ab September stand der Essay dann im Internet bei Wir sind Kirche. Den Link dazu finden Sie auch auf dieser Webseite weiter unten.
Bei der Herbst-Vollversammlung des Diözesanrates 2024 meldete ich mich zu Wort und verpackte meine Kritik charmant darin, wie wohl der Bischof in 100 Jahren die Diözese führen wird. Bischof Hanke hörte es sich an und sagte, „das ist halt Ihre Privatmeinung“, das war’s, er wendete sich ab. Der Diözesanratsvorsitzende Christian Gärtner nahm mich nach meiner zweiten Wortmeldung nicht mehr dran und begründete es mir hinterher damit, dass der Bischof mehr Kritik nicht vertragen könne. Dass der Diözesanratsvorsitzende die Kritik am Bischof reguliert, das sagt viel aus über die Diözese Eichstätt.
Zwar dürfen die Mitglieder des Diözesanrates in jeder Vollversammlung ein oder eineinhalb Stunden Fragen stellen. Wenn der Bischof ausweicht oder dran vorbeiredet, trauten sich nur wenige, nachzufragen; und wenn, bekamen sie oft dieselbe Antwort. Bei der Vollversammlung im März 2025 war der Diözesanratsvorsitzende aufgebracht darüber, nicht vorher über die Schließung der Dekanatsbüros informiert worden zu sein, obwohl der Vorstand erst kurz zuvor mit dem Bischof zusammengesessen war. Eine solche offene, heftige Konfrontation hatte es bisher noch nicht gegeben. Wobei ich einen Teil der Empörung auch dem Umstand zuschreibe, dass dadurch nun klar wurde, dass auch der Vorstand nicht weniger unwichtig ist wie der Diözesanrat selbst. Hanke antwortete mit einer langen Ausführung über die Notwenigkeit der Sparzwänge; er verfehlte damit das Thema, warum er die Leute nicht vorher miteinbezog. Auch kritisierte ein Jugendvertreter Hanke für die Schließung der Jugendstellen; Hanke antwortete, sie betrieben doch die Schulen weiter, das sei doch auch Jugendarbeit. Er sagte es m.E. wie jemand, der gewohnt ist, Dinge zu sagen, die so nicht stimmen, aber er nicht befürchten muss, dass jemand widerspricht. „Ach, wenn Sie meinen“, sagte der Jugendvertreter, so wie das augenrollende „ach, Boomer“, davor kapitulierend, dass der Bischof nicht auf seine Frage eingeht. In diesem Augenblick wurde m.E. klar, dass Bischof Hanke selbst das wenige an Autorität, das er jemals besessen haben mochte, verloren hatte.
Von Bischof Oster in Passau wird kolportiert, dass er zwar dazu auffordert, ihm alles zu sagen; aber wer es tut, so die Rückmeldung, der bekommt lediglich zu hören, dass er schon alles richtig mache. Ich habe ihm bei einer Vollversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern mein „Himmel 4.0“ in die Hand gedrückt und versucht zu erklären, warum das Evangelium in der Wissensgesellschaft neue Chancen hat, aber er hat kein Verständnis gezeigt. Vor ein paar Jahren habe ich gesprochen bei der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Männerseelsorge, und der Regensburger Bischof Voderholzer hörte mir mit geschlossenen Augen angestrengt zu. Am Ende sagte er sinngemäß: Sie sind weder konservativ noch liberal, ich kann sie nicht einschätzen. Und damit auch uninteressant. Anstatt sich inhaltlich mit den Ideen auseinanderzusetzen und durch Reibung eine gemeinsame Kirche zu schaffen, scheint er die Leute in Freunde und Feinde einzuteilen. Was für eine riesige Aufgabe kommt da auf uns zu, die Kirche synodal zu gestalten. Denn nichts ist schwieriger, als das Denken in den Köpfen, als Verhalten von Menschen zu ändern.
Wenn in den neuen Kirchengremien produktiv beraten werden soll, dann muss es möglich sein, einem Bischof von Eichstätt sitzungsöffentlich zu widersprechen oder ihn zu kritisieren, ohne dass deswegen sein Status beschädigt wäre und man sich als Querulant unbeliebt gemacht hätte – weil es schlicht normal ist. Und von den Mitgliedern wird ganz anders als bisher verlangt, sich zu positionieren, eine Meinung zu bilden und zu vertreten. Das sind keine Forderungen von Randgruppen, sondern langfristiges Ziel des früheren wie auch des neuen Papstes: Das synodale Prinzip ist die Zukunft der Kirche auf allen Ebenen. Die vom Papst Franziskus bestätigte Weltsynode schreibt, Bischöfe sollten sich in Zukunft vor den unteren Ebenen rechtfertigen müssen.
Gemeinsame Verantwortung: Gremien heute und morgen
Wie Kirche funktionieren soll, schreibt Apostel Paulus etwa im Korintherbrief: So wie die Zusammenarbeit von verschiedenen Organen im Körper, die einander ergänzen und interagieren. Unter den Zeitgeistbedingungen früherer Jahrhunderte mit Leibeigenschaft, Absolutismus oder streng in Form gepresster Massenindustrialisierung war das nicht möglich. Erst jetzt eröffnen sich auch für die Kirche Perspektiven auf eine Evangeliums gemäße innere Struktur. Durch die Notwenigkeit, Wissen im Team produktiv anzuwenden, verändern sich in der Arbeitswelt und dadurch auch in der Gesellschaft Organisationsformen.
Dabei wäre das längst geregelt, dass ein Bischof sich beraten lassen soll: Das Kirchenrecht (Can. 511) schreibt einen „Pastoralrat“ vor („…ist einzurichten“), der „den ganzen Teil des Gottesvolkes abbilden“ soll, also auch die Dekanate und die Berufsgruppen. Versehen ist diese Anweisung aber mit der schwammigen Einschränkung, „sofern die seelsorgerischen Verhältnisse es anraten“. Ich habe Amtschef Schäfers darauf hingewiesen, und er antwortete, dass das eben keine Pflicht sei; ich sehe das andersherum: „Ist einzurichten“ ist nicht eine Empfehlung, sondern gehört zur Konstitution der Kirche dazu. Und wenn die Eichstätter Bistumsleitung so ein Forum der Beratung nicht hat, dann müsste sie es begründen („Seelsorgerische Verhältnisse“).
Die Gremien, die wir bislang in der Diözese hatten, sind nicht miteinander verbunden, arbeiten getrennt voneinander, haben nicht denselben Informationsstand. Das ermöglicht ein „Teilen und herrschen“, aber verhindert eine lebendige Kirche. Aus seiner mangelnden Fähigkeit, sich diskursiv auseinanderzusetzen, hatte Bischof Hanke das Domkapitel entmachtet; den Pastoralrat still und leise aufgelöst; der Diözesanrat fungierte m.E. als Feigenblatt, in dem man sich über eine Kaffeekooperative in Südamerika informierte oder über Neues aus dem Ordinariat; in dem man aber die eigentlichen Probleme der Diözese nicht auf den Tisch brachte. Und wenn es dann dort doch mal deutlich wurde, hat Hanke es schlicht ignoriert. Es gibt den Priesterrat, einen Lenkungs- bzw. Perspektivkreis, bei dem nicht transparent ist, wer und warum da jemand mitmachen darf und was die gesprochen haben, und einen Steuerausschuss – nur letzterer hat mit seinem Vetorecht eine Wirkmacht.
Ich war 2012 in den Pastoralrat berufen worden. Auch dort wurde nicht ergebnisoffen über ein Problem diskutiert, sondern ein Vortrag angehört. Zuletzt hatte dieser Pastoralrat 2015 getagt und dann nicht mehr – ohne dass die Mitglieder über dessen Ende informiert worden wären. Offiziell war ich im Internet noch bis 2022 Mitglied dieses Pastoralrates. Dann erschien im Amtsblatt 2/2022 ein Dekret des Bischofs, dass der „Lenkungskreis“ die Aufgaben des Pastoralrates übernimmt – das wurde im Amtsblatt 5/2023 wieder aufgehoben.
Nachdem schon vorher mündliche Fragen zum Pastoralrat inhaltlich unbeantwortet blieben, habe ich beim Bischof schriftlich nach den Hintergründen der Dekrete gefragt. Von Amtschef Schäfers bekam ich daraufhin die lapidare Antwort, dass es den Pastoralrat nicht mehr gebe und ich wegen der Gremien doch selber auf der Webseite der Diözese nachsehen sollte. Von einem „Lenkungskreis“ – wer das ist und was der macht – ist dort nichts zu lesen. Über ein „Konsultorenkollegium“ heißt es auf der Webseite, es „nimmt die ihm vom universalen Kirchenrecht übertragenen Aufgaben und Befugnisse wahr“ – der Gläubige, der sich informieren will, weiß damit so wenig wie vorher. Wer so formuliert, will m.E. weder verstanden werden noch die Leute mitnehmen, sondern signalisiert: Da steigst Du eh nicht durch, lass es bleiben, geht Dich auch nichts an. Erst in einem weiteren Link versteht der Leser und die Leserin, dass es sich beim Konsultorenkollegium um das Domkapitel handelt. Im Januar 2024 sagte mir Amtschef Schäfers, dass der Pastoralrat aufgehoben wurde, weil dort nichts passiert sei – als ob das die Schuld der Mitglieder gewesen wäre.
Nach Auseinandersetzungen entmachtete der Bischof das Domkapitel, die Domkapitulare verschwanden aus ihren „Ministerien“; sie legten die Verantwortung für die Diözese nieder und arbeiteten als normale Pfarrer. Groll erzeugte wohl auch, dass Bischof Hanke in der Presse dem Domkapitel die Verantwortung für Debakel gab, ohne dass sie sich wehren können. Das Gremium gab es weiter, aber ohne die vorherigen Funktionen. Dafür hatte der Bischof leitende Ämter mit Personen auch aus fernen Teilen Deutschlands besetzt, die nicht in die vielfältigen Beziehungen hier eingebettet sind und m.E. auch weniger auf allgemeine Interessen achten als hier gewachsene Persönlichkeiten, sondern auf den ausgerichtet sind, der sie eingestellt hat.
Den bisherigen Diözesanrat (DR) halte ich nicht für eine Anlaufstelle für Probleme. Kein Bischof kommt, um ihn zu bitten, ihm bei einer Entscheidung zu helfen, sie mit Vorschlägen und Argumenten zu untermauern. Was das Ordinariat an neuen Umweltkonzepten erstellt hat, wäre dann relevant, wenn der DR schon bei der Entstehung mitwirken könnte.
Auf der Vollversammlung des Diözesanrates im März 2023 habe ich daher einen Antrag gestellt, der Diözesanrat möge ein Forum werden für Rückmeldungen, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Wenn jemand meint, dass die Bistumsleitung seine Anfrage nicht oder ausweichend beantwortet hat, dann solle der Diözesanrat der Ort sein, wo jemand sein Anliegen transparent neu stellen kann; wahrgenommene Entwicklungen im Bistum, tagesaktuelle Probleme im Kirchenapparat und im Gemeindeleben könnten offen thematisiert, Entscheidungen des Bistums hinterfragt werden. Das würde Missverständnisse ausräumen, das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen erhöhen, Schäden von schlechter Führung beheben, die Qualität von Entscheidungen verbessern, und insgesamt ein Klima schaffen, in dem die Zusammenarbeit bestimmt ist von Sachgründen und von Interessen der Kirche und weniger abhängt von persönlichen Beziehungen und Status. Das deckt sich auch mit dem, was in der Satzung steht.
Die Wortmeldungen darauf waren kritisch: „Sollen wir jetzt eine Art Betriebsrat werden?“ Jein: Wir sind kein Unternehmen, in dem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüberstehen; aber als Christen sind wir gemeinsam für die gesamte Kirche verantwortlich. Der Vergleich war unpassend, sorgte aber für ablehnende Haltungen. Eine andere Stimme meinte, da der Diözesanrat sich ja sowieso mit den Problemen der Diözese beschäftigt, sei der Antrag überflüssig. Diese Wahrnehmung teile ich absolut nicht – ich sehe nicht, dass die Gremien die Entscheidungen bisher mitgestalteten. Es blieb keine Zeit, vertieft darüber zu diskutieren. Elf Mitglieder des Diözesanrates stimmten dafür, 19 dagegen, die allermeisten, 35, enthielten sich – der Antrag war krachend gescheitert. Wollen die Laien in dem zentralen Gremium der Diözese Eichstätt also selbst gar keine echte Mitverantwortung übernehmen?
Das Mitreden ist bisher noch nicht gelernt worden. Jemand meinte zu mir, wir könnten doch dem Bischof nicht sagen, was er zu tun habe – genau so verstehe ich aber die Aufgabe eines Diözesanrates, Anregungen, Kritik und Wünsche zu formulieren. Auch wenn der Bischof letztlich selber entscheidet. Anderen ist ihr Arbeitsalltag anstrengend genug, die wollen in ihrem kirchlichen Ehrenamt nicht auch noch Probleme. Wieder andere sind altersmilde geworden, sie wollen Konflikten sowieso aus dem Weg gehen. Eine kirchliche Führungskraft meinte zu meinem Antrag auf Hinweisgeber (siehe unten), wenn ich Probleme mit dem Bischof hätte, dann sollte ich das doch direkt regeln und nicht den Diözesanrat damit behelligen – dabei hatte der aber nicht auf meine Anfragen geantwortet, und deswegen braucht es m.E. ein Gremium, in dem man auf den Tisch bringen kann, was sonst untergeht. Eine weitere Rückmeldung eines langjährigen Mitglieds ließ den Schluss zu, dass er meinen Antrag als Kritik an sich verstanden hat, da dieser Rolle und Befugnisse verändern will, weil der Diözesanrat in seiner bisherigen Form seinem Anspruch nicht gerecht werde. Vielleicht war das ja nicht falsch, wie der DR früher funktionierte, aber er kann so wie bisher nicht weitermachen, soll es in Eichstätt eine lebendige Kirche geben.
Nun wurde aber der Vorstand des Diözesanrates aktiv und ging auf die anderen Gremien mit der Frage zu, wie ein gemeinsames Diözesangremium zu gestalten ist. Er veranstaltete ein Forum, wie in Stuttgart und in Freiburg Laien und Bischof zusammenwirken. Von Bischof Hanke hatte ich den Eindruck, dass er zwar verbal für ein neues Gremium ist, aber die Aktiven vor sich hin diskutieren ließ und in Wirklichkeit nichts ändern mochte. Mit der kommenden Vollversammlung am 27. September 2025 soll es von der Bistumsleitung einen neuen Anlauf geben für ein „Diözesangremium“, aber mit nur vier Delegierten des Diözesanrates. Das halte ich für zu wenig, um das „Volk Gottes“ abzubilden, wie es im Kirchenrecht heißt.
Doch wie funktionierte der bestehende Diözesanrat, als ich den Konflikt um die verschwundene Ablassurkunde dort zum Thema machte?
„Hinweisgeber sind anzuhören“
Für die DR-Vollversammlung im März 2024 habe ich den Antrag gestellt, Hinweisgeber seien anzuhören. Ich schilderte auf einer Seite den Fall und wollte damit Regeln schaffen, dass Zeugenaussagen auch wirklich geprüft werden. Bischof Hanke rief den Diözesanratsvorstand und verlangte, dass ich meinen Antrag zurückziehen sollte, siehe oben („meine Mitarbeiter schützen“), wozu ich aber nicht bereit war. Der vom DR-Geschäftsführer vorgeschlagenen Kompromiss war, dass ich den konkreten Fall weglasse und nur beantrage, dass Hinweisgeber zu hören sind. Weil das wenigstens etwas ist, habe ich mich darauf eingelassen. Doch der Vorsitzende ließ mich erst sieben Minuten vor Ende der Vollversammlung zu Wort kommen. Und dann entrüstet sich der Missbrauchsbeauftragte, warum ich nicht vorher zu ihm gekommen sei. Ohne Aussicht, den Mitgliedern den Fall zu erklären, zog ich den Antrag zurück. Um ihn im September 2024 wieder zu stellen. Der Geschäftsführer sagte mir, diesmal hätte ich ja genug Zeit, doch der Vorsitzende Christian Gärtner, der kein Zeitlimit vorgegeben hatte, unterbrach mich nach wenigen Minuten und gab dem Generalvikar das Wort. Alberter sagte, es stimme nicht, dass der Bischof mir nicht geantwortet hätte, und dass ich ein Gespräch mit dem Amtschef dazu geführt hätte. Der Vorsitzende unterband, ihm zu antworten. In einem funktionierenden Diözesanrat würde nun überprüft werden, was stimmt. Der Generalvikar Alberter müsste die Antworten des Bischofs, die er behauptet, vorlegen, und dann wäre klar, dass es die nicht gibt, und dass er sich korrigieren müsste. Und ja, der Amtschef hat mich angehört, aber das war kein Gespräch, in dem Sachverhalte durchdacht werden und man gemeinsam bespricht, wie jetzt weiter vorzugehen ist.
Die Mitglieder des Diözesanrates erlebten einen Generalvikar und einen Vorsitzenden, die mich einschränkten, und trafen danach ihre Entscheidung, meinen Antrag abzulehnen. Es gab nur eine einzige ältere Dame, die sich dafür aussprach, dass Hinweisgeber in Zukunft zu hören sind. So schwer ist es, bisherige Verhaltensweisen zu ändern, und so groß ist der Weg, den wir bei der synodalen Umgestaltung vor uns haben.
Ich habe sechs Wochen gebraucht, um das zu verdauen. Und mich dann entschieden, die Institution Kirche auch weiter auszutesten und nach Rom zu schreiben, um Hilfe zu bitten für die Diözese Eichstätt, die sich nicht mehr von alleine reformieren könne und dringend Hilfe von außen bräuchte, mit dem verlorenen Ablassbrief als Aufhänger. Jeder, dem ich das erzählte, lachte mich aus, das würde nichts bringen. Nach Hl.-Drei-Könige schickte ich meinen Brief über den Nuntius sowohl an Papst Franziskus als auch an das Bischofs-Dikasterium, dem damals der heutige Papst Leo vorsaß. Im März bekam ich Post, ein Legat bedankte sich für die Information und schrieb, ich solle mir sicher sein, dass sie meinen Brief sehr aufmerksam gelesen hätten. Zur selben Zeit im März, so zeigte es sich im Nachhinein, hat der Vatikan den Rücktritt von Bischof Hanke angenommen. Und ich bin ratlos, was ich davon halten soll.
Denn meinen Bitten, den Fall aufklären zu lassen, Regeln vorzugeben und die Leute an einen Tisch zu bringen, hat auch „Rom“ nicht entsprochen. Wenn bisher „Rom“ gesprochen hat, dann war nie klar, welcher Kardinal da was entscheidet, mit welchem Argument, und ob da Missverständnisse oder Fehlinformationen vorliegen. Zu den anstehenden Reformen gehört daher m.E. auch, dass der Apparat klarer begründet, wie und warum er eine Entscheidung trifft. Und ich finde es grundfalsch, dass Bischof Hanke zurückgetreten ist. Mir wäre es lieber gewesen, der Vatikan hätte einen Vertreter entsandt, der an der Seite des Bischofs all die Themen angegangen wäre, die zu kritisieren sind. Denn was nützt sein Rücktritt, wenn nicht gemeinsam reflektiert und geheilt wird, was geschehen ist? Ein Rücktritt verändert gar nichts. Sollte ein neuer Bischof von Eichstätt nicht einen Schnitt und bewusst machen, was jetzt alles anders sein wird? Oder gelten die unausgesprochenen Regeln wie bisher mit denselben Führungspersonen weiter so wie bisher?
Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich wütend bin. Aber das bin ich nicht. Ich bin vor allem traurig. Weil ich mir eine lebendige und wirkmächtige Kirche wünsche, in der es Angstfrei und konstruktiv zugeht. Wenn die Diözese ehrlich aufarbeiten kann, was unter Mixa und Hanke war, kann daraus etwas völlig Neues entstehen und das einen Aufbruch ermöglichen.
Wer hat verloren?
Ich sitze mit meiner Familie im griechischen Restaurant, als sich ein Alt-Lentinger zu mir setzt. Er ist der einzige, von dem ich weiß, dass er sich öffentlich dazu bekannte, dem Stefan Weyergraf-Streit zu glauben. Er war ihm begegnet, direkt nachdem dieser das Verschwinden der Urkunde bemerkt hatte, und erzählte, wie erschüttert dieser war. Nun hat er sich doch dem Konsens der anderen angeschlossen. Er sagt zu mir, er sei ja eine ehrliche Haut, und müsse mir jetzt mal sagen, dass ich es völlig übertrieben habe. Sinngemäß sagt er, ich hätte nur deshalb immer weiter gemacht, weil ich nicht verlieren könne. Interessant, wie die anderen denken: Geht es ums Gewinnen und ums Verlieren? Wer setzt sich durch? Wer hat mehr Gewicht und kann bestimmen, ob der Fall untersucht oder ob das verhindert wird? Hat jemand die Macht, die Stärke von Regeln durchzusetzen, oder ist die Macht des „Mir-san-Mir“ stärker?
Dass ich verloren hätte, so habe ich das nie gesehen. Hätte ich weggeschaut, dann wäre ich ein Verlierer. Hätte ich mich dem Gruppendruck gebeugt und kein eigenes Gewissen, dann wäre ich ein Verlierer. Würde ich es unversucht lassen, für eine bessere Kirche zu streiten, dann wäre ich ein Verlierer. Was ich gewonnen habe, ist ein realistisches Bild, wie Kirche und Staat funktionieren. Mit diesem Essay bin ich nur der Chronist. Verloren haben die Lentinger, denen ein wesentliches Stück ihrer Geschichte abhanden gekommen ist. Verloren hat die Kirche, die es immer noch nicht schafft, ihre bisherige Kultur zu ändern, die Betroffenen an einen Tisch zu bringen und die gegensätzlichen Aussagen aufzuklären. Verloren haben die Bürger, weil sie sich m.E. nicht mehr darauf verlassen können, dass die Staatsanwaltschaft zielführend ermittelt.
Der Alt-Lentinger sagt, er gehöre ja nicht zu denen am Dorf, die meinen, mir ginge es ja nur darum, dem Pfarrer eine reinzuwürgen. Aber er wisse auch nicht, was mich da umtreibe. Wenn da Aussage gegen Aussage stünden, müsste man das doch auf sich beruhen lassen. Nein sage ich, dann müsste man die Spuren untersuchen und anhand der Fakten sichern, was stimmen kann und was nicht. Ich sagte, es geht darum, die Kirche zu verändern. Dass Schluss ist mit dieser strukturellen Gewalttätigkeit, dieser autokratischen, intransparenten Missbrauchskultur, die das Evangelium nur vorliest, ohne danach zu handeln.
Aber die Kirche könne doch kein einzelner ändern, sagt der Alt-Lentinger, und fügt hinzu: Er habe neulich ein Interview mit Kardinal Marx gehört, was die Kirche alles unternehme, um gegen den Missbrauch vorzugehen. Nein, antworte ich, der Umgang mit dem fehlenden Ablassbrief in Lenting zeigt, dass das, was Kardinal Marx da sagt, nicht reicht. Der Bischof, den wir in 100 Jahren in Eichstätt haben werden, der wird das ja alles ganz anders machen: Er wird die Menschen überzeugen wollen; die Engagierten miteinbeziehen; nach geistlichen Gütern suchen wie Ehrlichkeit statt nach weltlichen wie Macht. Aber wenn sich die Verhältnisse in 100 Jahren in Eichstätt geändert haben werden, dann nicht von alleine. Sondern weil sich Menschen dafür eingesetzt haben. Weil es Menschen gab, die für sich erkannten, dass sie nicht nur für ihr individuelles Tun verantwortlich sind. Sondern auch für das, was sie immer widerspruchslos hingenommen hatten. Und nun den Mund auftaten.
Erik Händeler
ist freier Wirtschaftsjournalist, Buchautor und Vortragsredner mit Schwerpunkt Zukunft und Organisation, mit Schnittpunkten zu Religion. Er ist in zahlreichen kirchlichen Verbänden und Gremien aktiv, darunter auch berufenes Mitglied im Diözesanrat Eichstätt sowie im Dekanatsrat Ingolstadt.
Weitere Informationen zum Thema